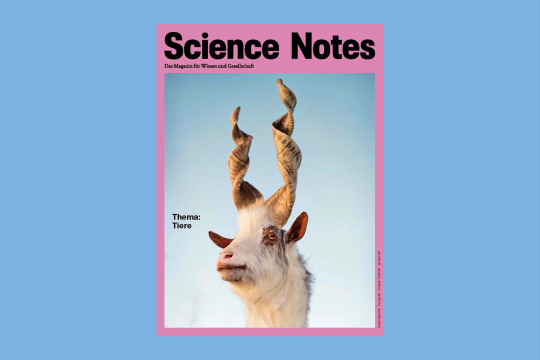Die Schoko-Engel
oder: Kann Schokolade fair sein?
Jede Tafel Schokolade hat zwei Seiten: gut als Stimmungsaufheller, schlecht fürs Gewissen. Was, wenn für meinen Genuss Kinder schuften müssen? Drei Fragen zu einer Süßigkeit mit bitterem Beigeschmack. Und Antworten, die der Himmel über Hamburg schickt.
1. Schoki oder keine Schoki?
Soll ich’s wirklich machen oder lass ich’s lieber sein? Es ist eines meiner Lieblingslaster, ich nenne es Schokrastination: Wenn ich, wie jetzt, vor einer weißen Seite sitze, auf der eigentlich so langsam mal ein Text stehen sollte, überkommt mich zuverlässig die Lust auf eine süße Sünde. Was könnte in diesem Moment attraktiver sein, als erstmal den Stift beiseitezulegen und ihr nachzugeben? Alpenmilch … Nugat … Weiße Schokolade … Weiße Seite!
Ich lege den Stift beiseite. Und setze mich aufs Rad, eine kurze Tour runter zur Reeperbahn. Das Süßwarenregal des dortigen Penny-Markts, auf der sündigsten Meile der Welt gelegen, scheint mir der richtige Ort, um eine ganz grundsätzliche Frage zu klären: Ist es gut, Schokolade zu essen? Gut nicht in Bezug auf meine Figur (oder meinen Text), sondern was die Bäuerinnen und Bauern in Westafrika betrifft, von deren Plantagen rund zwei Drittel des weltweit produzierten Kakaos stammen. Viele von ihnen können davon mehr schlecht als recht leben. Im Kakaosektor arbeiten Hunderttausende Kinder, laut einer Studie des National Opinion Research Center (NORC) der Universität Chicago waren es 2018/19 allein in den Hauptproduktionsländern Ghana und der Elfenbeinküste rund 1,5 Millionen.

Im Supermarkt leuchten, kieztypisch, Neonschriftzüge an den Wänden. »Geil, dass ihr da seid!«, begrüßt einer davon am Eingang die Kundschaft. Gleich hinterm Gemüse (»Knackige Dinger«) warten regalweise Schokoladentafeln, -riegel, -pralinen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und auch ein Stückchen links davon, auf meiner Schulter, regt sich etwas: Ein Engelchen bringt sich in Position, es spricht mit der Stimme von Friedel Hütz-Adams, einem Lieferketten-Experten des Südwind-Instituts für Ökonomie, mit dem ich kürzlich ein Interview geführt habe. »Kakao ist Hochrisiko!«, flüstert es mir ins Ohr. »Wenn es um Menschenrechtsverstöße wie Kinderarbeit geht, hat jedes Herkunftsland von Kakao ein großes Risiko!« In Ghana oder der Elfenbeinküste etwa, so die Engelsstimme, würden die Menschen auf den Kakaoplantagen meist nur rund halb so viel verdienen, wie für ein existenzsicherndes Einkommen nötig wäre. Unter diesen Umständen könnten sie auf die Arbeit ihrer Kinder schlicht nicht verzichten.
Seufzend lege ich die Schokoladentafeln zurück ins Regal. »Was soll das?«, fragt das Engelchen auf meiner Schulter mit hochgezogener Augenbraue. »Keine Schokolade mehr zu kaufen, würde dazu führen, dass der Kakaopreis fällt. Damit wäre den Bäuerinnen und Bauern nicht geholfen.«
Keine Schokolade ist auch keine Lösung? Aber was dann? »Schreib dem Hersteller«, rät das Engelchen. »Könnt ihr garantieren, dass die Bäuerinnen und Bauern ein existenzsicherndes Einkommen haben? Wenn nicht dieses Jahr: Gibt es diese Garantie für das nächste Jahr?«
Schreiben also? Dann würde ja gleich die nächste weiße Seite auf mich warten … Das muss doch auch einfacher gehen, denke ich, und erspähe im Schokoregal gleich eine ganze Reihe von Fairtrade-Logos. Na, also! Da, diese dunkelblaue Eigenmarke-Tafel: Alpenvollmilch, 100 Gramm, 69 Cent – Fairtrade! Und da, eine andere Eigenmarke: Ganze Nuss, Edel-Vollmilch, 99 Cent – Fairtrade! Voller Vorfreude stürme ich zur Kasse. Das ist nicht nur einfach, das ist auch günstig. Geil, dass ich da war!
»Freu dich nicht zu früh!«, höre ich beim Rausgehen eine Stimme hinter mir rufen. Offenbar war mir im Überschwang das Engelchen von der Schulter gefallen.
2. Ist faire Schokolade fair enough?
Als ich auf das Fahrrad steige, hat das abgestürzte Engelchen mich eingeholt. Es nimmt wieder auf meiner Schulter Platz und krallt sich beidhändig an der Jacke fest, damit sich das Malheur im Fahrtwind nicht wiederholt. Abschätzig blickt es auf meinen Rucksack, in dem die Schokotafeln mit den Fairtrade-Labels verstaut sind. »In der Kakaobranche ist es seit langem ein offenes Geheimnis: Eine Zertifizierung garantiert keine Einhaltung von Menschenrechten«, ruft es mit der Stimme von Friedel Hütz-Adams herüber, während ich die Reeperbahn entlang radle. »Der Fairtrade-Mindestpreis garantiert den Kakaofarmen auch kein existenzsicherndes Einkommen.«
Wie bitte?! Ich mache einen ungläubigen Schulterblick zum Engelchen, das nun einen betont abgeklärten Gesichtsausdruck aufsetzt. »Tja, auch manche Einzelhändler waren erstaunt, als ich ihnen davon erzählte.« Das Engelchen macht eine Rechnung auf: Nur selten sei der Fairtrade-Mindestpreis für Kakao in den vergangenen zehn Jahren höher gewesen als der Weltmarktpreis. Und die zusätzlich gezahlte Fairtrade-Prämie habe, Stand vergangenes Frühjahr, bei nur etwa zehn Prozent dieses Preises gelegen. »Was hilft ein Aufschlag von zehn Prozent, wenn ein Kakaobauer nur die Hälfte dessen verdient, was in Ghana oder der Elfenbeinküste als existenzsicherndes Einkommen gilt?«

Die Stimme des Engelchens wird nun deutlich lauter, als es der Fahrtwind erfordern würde. »Siegel wie Fairtrade sind angetreten, um die Märkte zum Besseren zu verändern«, ruft es. »Allerdings standen sie bald vor einem Problem: Wenn sie aus der Nische raus wollten, durften sie nicht viel teurer sein als der konventionelle Markt. Damit sind sie heute aber oft kaum mehr als eine Beruhigungspille für die Öffentlichkeit!«
»Moooment mal!«, ruft es plötzlich von meiner anderen Schulter. »Diese Formulierung finde ich diskreditierend!« Ich blicke nach rechts. Dort ist, heruntergeflattert aus dem Himmel über Hamburg, ein zweites Engelchen gelandet. Seine Stimme klingt wie die von Claudia Brück, Vorständin von Fairtrade Deutschland e.V. – auch mit ihr hatte ich unlängst gesprochen. »Fairtrade ist nicht perfekt«, fährt das Engelchen zur Rechten fort. »Fairtrade ist nicht die Lösung für alle Probleme. Aber es unterstützt Kleinbauern, selbstbestimmt zu produzieren, macht Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit für sie, verbessert ihre Verhandlungsposition auf dem Markt. Das sind, neben Mindestpreis und Prämie, viele kleine Schritte, die nachweislich wirken. All das als Beruhigungspille abzutun, finde ich wirklich ärgerlich.«
Die Antwort von der linken Schulter folgt prompt. »Ohne existenzsicherndes Einkommen helfen alle gutgemeinten Maßnahmen nichts! Andererseits bietet man Firmen mit solchen Labels eine billige Scheinlösung, hinter der sie sich verstecken können.« Das Engelchen versucht nun, den gegelten PR-Tonfall eines Unternehmenssprechers zu imitieren: »Ja, wir haben doch ein Label drauf! Was wollen Sie eigentlich noch von uns?«
Engel links, Engel rechts – mir fällt es schwer, mich auf den Verkehr zu konzentrieren. Immerhin, denke ich, scheint sich schon mal eine Antwort auf die Frage herauszukristallisieren, ob es gut ist, Fairtrade-Schokolade zu essen: Jein.
3. Geht das Ganze nicht auch besser?
Etwas weitergekommen bin ich, und doch fühlt es sich ein bisschen so an, als würde ich auf der Stelle strampeln. »Liebe Engelchen, geht das Ganze nicht auch besser?«, rufe ich in den Fahrtwind. Ein paar Passanten auf dem Gehsteig drehen sich verdutzt nach mir um. »Gibt es nicht Schokolade, von deren Verkauf die Menschen auf den Kakaoplantagen wirklich gut leben können?«
»Naja«, ruft von der linken Schulter das Engelchen mit der Stimme von Friedel Hütz-Adams. »Es gibt Unternehmen, die zeigen, dass es geht. Tony’s Chocolonely zum Beispiel zahlt deutlich höhere Prämien, geht längerfristige Verträge ein, baut verlässliche Verbindungen zu Kooperativen auf – und hat damit die Kinderarbeit massiv reduziert.«
Das Engelchen zur Rechten, dessen Stimme der von Fairtrade-Vorständin Claudia Brück so erstaunlich ähnelt, springt triumphierend auf: »Du weißt aber, dass Tony’s Chocolonely Fairtrade-zertifiziert ist?«
Auch das linke Engelchen springt nun auf, als wolle es die Unterhaltung mindestens auf Augenhöhe fortführen. »Ja, aber sie gehen eben ein paar entscheidende Schritte weiter«, ruft es. »Warum setzen Zertifizierer wie Fairtrade den Schokoladenkonzernen nicht eine Frist und sagen: Bis 2025 zahlt ihr ähnlich faire Löhne – oder ihr dürft auf eure Schokolade kein Nachhaltigkeitslabel mehr drauf tun?«
Das rechte Engelchen verdreht die Augen. »Da überschätzt du die Verhandlungsposition von Fairtrade. Ohne politische Rahmensetzungen wird es bei einzelnen Leuchttürmen bleiben.«
Politische Rahmensetzungen also? Das klingt ja, als schwebe ihm eine gesetzliche Regelung vor, die den Firmen faire Arbeitsbedingungen und Bezahlung vorschreiben würde, entlang ihrer gesamten Lieferketten! Etwas ähnliches also wie das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, nur größer, umfassender, mächtiger, etwas, das um den Jahreswechsel herum schon greifbar nah schien, ehe die FDP es mit ihrer Blockadehaltung zu Fall brachte: »Braucht es vielleicht ein europäisches Lieferkettengesetz?«, frage ich in den Fahrtwind. »Jawoll!«, kommt es unisono von beiden Schultern zurück. Endlich mal eine erfreulich klare, erfreulich einvernehmliche Antwort.
Zuhause angekommen, verabschiede ich mich von den Engelchen, öffne die erste Tafel Schokolade und setze mich an meinen Text. Und ich fasse einen Vorsatz: Bis das EU-Lieferkettengesetz tatsächlich kommt, werde ich meine Schokrastinationsgelüste an den Leuchttürmen ausrichten.
Es gibt einige Schokoladenmarken, die teils weit über die Fairtrade-Standards hinausgehen und so einen Beitrag für existenzsichernde Einkommen ihrer Kakaoproduzenten leisten. Dazu gehören neben dem Pionier Tony’s Chocolonely, der vor rund 20 Jahren in den Niederlanden startete, und der Marke Jokolade von TV-Entertainer Joko Winterscheidt, die seit 2021 im Handel ist, auch die Eigenmarken Choco Changer von Aldi, Way To Go von Lidl und Very Fair von Rewe.
Das deutsch-ghanaische Schoko-Start-up Fairafric, 2016 in München gegründet, geht noch einen Schritt weiter: Es produziert seine Schokolade vor Ort in Ghana, holt damit einen größeren Teil der Wertschöpfungskette ins Land – und möchte auf diese Weise Schokolade »entkolonialisieren«.
Erschienen am 16. Mai 2024
Newsletter
Jeden Monat ein Thema. Unseren Newsletter kannst du hier kostenfrei abonnieren: