Die Zeit erlebt jeder anders. Aber eine Erfahrung teilt gerade die ganze Welt: Das Leben ist aus dem gewohnten Takt geraten. Was macht das mit Bewusstsein, Psyche und Körper?
Glücklich ist, wer einen Hund hat! Meiner ist in diesen Tagen nicht nur Isolationsgefährte, sondern auch Passierschein. Tel Aviv steht unter »Full Lockdown«. Wer keinen systemrelevanten Beruf oder keinen Hund hat, darf das Haus nur noch im 100-Meter-Radius verlassen. Ich stehe über der Bucht von Jaffa und blicke auf einen Strand, der nun seltsam leer wie eine Wüstendüne zwischen Meer und Hochhaustürmen liegt. In anderen Frühsommern war die Promenade rund um die Uhr von Joggerinnen und E-Bikes bevölkert, in Outdoor-Mucki-Buden wurde an Bizepsen gerissen. Darüber lag ein Soundteppich aus Autogehupe, den Boomboxen der Sonnenanbeter und dem »Pockpock« der Matkot-Spieler. Es scheint wie eine ferne Erinnerung. Schlügen nicht die Wellen im gewohnten Rhythmus an die Kaimauer – man könnte meinen, das Raum-Zeit-Gefüge sei völlig auseinandergefallen.
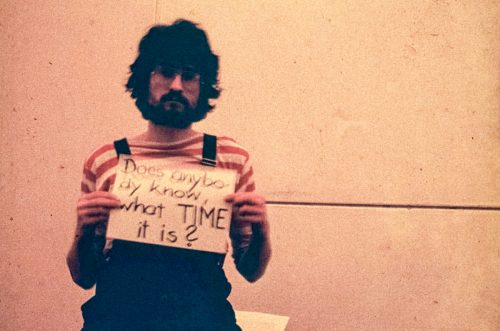
Wir haben kein Sinnesorgan für die Zeit. Aber wenn es nach der Physik geht, kommt das Ohr am nächsten heran. »Frequenz, Klangfarbe, Rhythmus – sehr viele Höreigenschaften haben mit Zeit zu tun«, erklärt Norman Sieroka. Wir sind auf der Videokonferenzplattform Zoom verabredet, mehrfach hatte ich die Zeitverschiebung nach Zürich überprüft. Für mich ist es der erste fixe Termin seit Wochen. Der Professor dagegen ist busy. Das virtuelle Semester beginnt bald. Technisches muss geklärt werden, rechtliche Fragen. Er findet das spannend. »Es gibt Bereiche, die sich gerade lockern, in anderen herrscht plötzlich Entscheidungsdruck.« Das betrifft Kassenkräfte, die sich um Spuckschutz und Abstände kümmern müssen, genauso wie Politiker und Mediziner, die gegen das Virus anrennen.
Das kleine t
Sieroka kennt sich aus mit der Zeit, oder besser: den Zeiten. Als Physiker fasziniert ihn, dass fast jede Theorie etwas anderes unter dem kleinen t versteht. Newton brauchte die absolute Zeit, um damit die Gravitationsgesetze aufzustellen und die Himmelsmechanik zu erklären. In Einsteins Relativitätstheorie wurde sie zur vierten Dimension. Aber immer geht es in der Physik um die Lage des t auf einer Linie, um früher oder später – um die reine Lagezeit also. Darauf basiert auch unsere gesellschaftliche Zeit: von der Jahreszählung ab Christi Geburt bis zum Zugfahrplan. Aber Sieroka ist auch Philosoph. »Dinge, die vorgestern noch morgen sind, sind heute schon Vergangenheit. Kompliziert, oder?« Augustinus unterschied erstmals zwischen einer physikalisch messbaren und einer subjektiv erlebten Zeit: »Was also ist Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht.« Tempus fugit, die Zeit flieht. Eine Antwort fand der Kirchenvater dann doch: Die Zeit kommt aus der Zukunft, die nicht existiert, in die Gegenwart, die keine Dauer hat, und geht in die Vergangenheit, die aufgehört hat zu bestehen. In unserem Bewusstsein ist Zeit also dynamisch. Philosophen sprechen deshalb von Modalzeit. »Dieser Verschub« – also das Phänomen, dass ›Jetzt‹ in fünf Sekunden schon ein anderes ist – »ist für unser Erleben extrem wichtig«, sagt Sieroka. »So funktioniert Erinnerung.«
»Dinge, die vorgestern noch morgen sind, sind heute schon Vergangenheit.«
Lagezeit und Modalzeit haben also beide ihre Berechtigung. Aber was passiert, wenn Weltzeit und Eigenzeit auseinanderklaffen? Bevor wir das Virus zu bremsen versuchten, haben wir mit Yoga und Achtsamkeitsübungen versucht, uns selbst zu entschleunigen. Jetzt sind viele dazu gezwungen. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht von einer historischen Chance, dem Hamsterrad zu entfliehen: Während die Welt sich digital auf Spitzengeschwindigkeit hochgetunt hat, erlebt die Gesellschaft eine Vollbremsung. Sieroka glaubt nicht an den großen Reset-Knopf: »Das ist zu pauschal: Vorher war alles zu schnell und mit Corona finden wir das richtige Tempo.« Schon deswegen, weil nicht alle die Krise durch ein Brennglas erleben. Für den Arbeitslosen mag die Zeit stillstehen, für die Krankenschwester rasen, manch ein Bauarbeiter aber spürt vielleicht gar keinen großen Unterschied. In der Retrospektive wird ein Paradox daraus. Wer nichts erlebt hat, wird nichts zu erzählen haben. Die tröpfelnden Tage schnurren in der Erinnerung zusammen. Wer die Minuten nicht zählt, weil so viel passiert, wird die Krise im Nachhinein als endlose Kette von Ereignissen beschreiben.
Im Takt mit der Weltzeit
»Für unser Wohlbefinden ist es wichtig, physikalische und gesellschaftliche Taktung mit unserem eigenen Takt in Gleichklang zu bringen«, sagt Sieroka. Sich abgehängt zu fühlen von der Weltzeit, bedeutet Stress – aber genauso das Vorauslaufen. »Das ist, als ob Sie im Restaurant die Rechnung bestellen, während alle anderen noch essen. Dann langweilen sie sich.« Oder übersetzt auf die Corona-Zeit: Wenn man so darauf bedacht ist, den Leerlauf produktiv zu nutzen, dass man gleichzeitig ein Buch anliest, die Steuererklärung anfängt und einen Freund anruft. Ich fühle mich ertappt.
Wie synchronisieren wir uns also mit der Weltzeit? »Was die Psychologen jetzt empfehlen, macht auch aus philosophischer Sicht Sinn«, sagt Sieroka: »Rituale setzen.« Aber auch dabei gilt es, die Balance zu finden. Einerseits wollen wir, dass sich Ereignisse in Zyklen wiederholen, wie der Sonnenaufgang. Auf der anderen Seite brauchen wir die lineare Komponente, eine Entwicklung. Neues erleben, aber vor einem Muster, das man wiedererkennt. »Wir sollten regelmäßig zu Mittag essen, aber das Gericht darf sich abwechseln.« Die Philosophie nennt das Kontraststeigerung. Denn wenn sich plötzlich alles auf einmal ändert, sei das desaströs. »Dann kann ich ja gar nicht mehr sagen, wer ich bin«, sagt Sieroka: »Es gibt keinen geschlossenen Lebensplot mehr.« Rituale helfen also auch, sich nicht ganz von der Vergangenheit zu lösen.
»Wir haben gerade eine totale Präsenzwahrnehmung.«
Die macht mir gerade keine Sorgen. Aber wie damit umgehen, dass vielen Menschen nun die Zukunftsperspektive fehlt? Als Journalistin gehöre ich zu den Privilegierten, auch nach der Krise wird man Zeitungen lesen. Aber wann werde ich wieder reisen können, für eine Recherche oder um meine Familie zu besuchen? Und vor allem: Wie heitere ich Freunde auf, die wegen des Lockdowns ihren Job verloren haben? Diesmal skype ich nach Freiburg. Dort sitzt der Psychologe Marc Wittmann im Homeoffice. Tiefenentspannt, wie er sagt. Drei Aufsätze hat er in diesen Tagen geschrieben, ohne störende Anrufe oder Besprechungen. »Wir haben gerade eine totale Präsenzwahrnehmung«, sagt Wittmann. Und für jemanden, der sonst viel Zeitdruck spürt, könne es durchaus angenehm sein, dass sich ein Montag wie ein Sonntag anfühlt. Vorausgesetzt natürlich, man sitzt nicht mit drei Kindern im Homeoffice oder kämpft mit existenziellen Sorgen.
Wer das Hamsterrad im Kopf nicht abschalten kann, also trotz leeren Terminkalenders auf einem hohen Erregungslevel bleibt, dem helfen zielgerichtete Aufgaben – und wenn es nur eine Putzorgie ist. »Zukunftsorientierung führt zu Wohlbefinden«, sagt Wittmann. Ganz ohne Sinn und Ziel neigten Menschen generell zu Depression: »Sie stecken fest in der Zeit.«
»Zukunftsorientierung führt zu Wohlbefinden.«
Depressive, aber auch Patienten mit Angststörungen spüren keinen »Flow« mehr, also das beglückende Erlebnis, in einer Beschäftigung ganz aufzugehen. Sich fallen zu lassen, die Zeit und auch sich selbst zu vergessen. Von dem EU-Projekt, das Wittmann derzeit mit Kollegen und Psychiatern plant, kann man sich vielleicht auch was für den Lockdown abgucken. Eingebettet in eine Therapie wollen sie Patienten das Flow-Gefühl vermitteln: mit fesselnden Videospielen. Per EEG messen sie dabei, was im Gehirn passiert.
Ich erzähle, dass ich für eine Reportage gerade selbst mit meinem Zeitgefühl experimentiert habe. Und zwar habe ich versucht, via Google Street View ein Wandererlebnis zu simulieren. Den Flow habe ich nicht erlebt, eher das Gegenteil, eine Art von schläfriger Trance. Den Psychologen erinnert das ans norwegische Slow TV. Premiere machte das Programm mit der Reise eines Postschiffs durch die Fjorde. Eine Kamera am Bug filmte das Geschehen in Echtzeit. Furchtbar langsam, aber doch bewegter als ein Standbild. Im Kontrast zu hektischen Videoschnipseln und stressigen Nachrichten soll es den Zuschauer zwingen, Details wahrzunehmen. Und das entschleunigt scheinbar. »Das war damals ein Renner!«
Die Zeit bremsen
Dabei kann man die gefühlte Zeit auch ohne Hilfsmittel bremsen. In einer früheren Studie ließ Wittmann Probanden kurze Zeiträume von wenigen Sekunden einschätzen und untersuchte ihre Hirnaktivität. Er stellte fest, dass dabei die Insula aktiv wird. Sie liegt direkt unter der äußeren Hirnrinde. Hier laufen alle Informationen über den Zustand des Körpers zusammen, wie zum Beispiel Temperatur, Juckreiz, aber auch der Herzschlag.
Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche, viele große Denker setzten auf lange Spaziergänge, um den Kopf zu lüften. Aber es reichten schon fünf Minuten, sagt Wittmann, um die Insula zu befeuern. Ohne Smartphone natürlich. Je weniger Ablenkung, desto mehr Signale kann sie empfangen. Und diese werden mit Informationen aus der Umwelt gekoppelt – so entsteht unser Gefühl für den Körper in Raum und Zeit. Ein umgekehrtes Flow-Erlebnis, sozusagen: Anstatt die Zeit zu vergessen, verortet man sich ganz bewusst darin. Wir nehmen plötzlich nicht nur uns selbst wieder wahr, sondern auch, wie lange sich fünf Minuten anfühlen können. Ich beschließe, nächstes Mal ohne Virologen-Podcast im Ohr Gassi zu gehen und die Zeit draußen voll auszudehnen.
Ticken unsere Körper im Lockdown noch richtig?
Eine Frage bleibt noch offen. Fürs Wohlbefinden sollten wir also danach streben, unsere Eigenzeit mit der Weltzeit zu synchronisieren, unser Bewusstsein können wir dabei über die Wahrnehmung justieren – doch ticken unsere Körper im Lockdown überhaupt noch richtig?
Dass wir keinen natürlichen Tag-Nacht-Wechsel brauchen, um einen Biorhythmus zu haben, stellten die Forscher Jürgen Aschoff und Jürgen Zulley schon in den Sechzigern fest. Damals wurden Freiwillige wochenlang in einen Bunker gesperrt, durften aber selbst das Licht einschalten. Die biologischen Funktionen wie Körpertemperatur und Schlafperioden blieben tatsächlich im Takt. Allerdings entkoppelten sie sich voneinander. Außerdem schummelte sich im Bunker eine Stunde zum Tag dazu. Er dauerte im Mittel 25 Stunden. Die Rhythmen erzeugt unser Körper demzufolge selbst, für ihre Synchronisation sind wir jedoch auf die Natur angewiesen. Das Andecheser Bunkerexperiment gilt als der Anfang der Chronobiologie.
Es werde Licht
»Den Konflikt zwischen externer Zeit und Innenzeit gibt es seit Erfindung der Uhr«, sagt Christian Cajochen. Er ist Chronobiologe an der Uni Basel. Dort macht er unter anderem Grundlagenforschung zur Wirkung von Licht auf unseren Körper. Zum Beispiel untersucht er, welche Fotorezeptoren im Auge auf welche Wellenlänge reagieren. Und wie sich die Effekte auf Schlaf, Pupillengröße oder Lernverhalten auswirken. »Wir wollen das dann in zirkadianes Bildschirmlicht umsetzen.« Das ist künstliches Licht, das die biologische Uhr nicht oder sogar positiv beeinflusst.
Im Bunker lebe ich zwar nicht, aber richtig viel Sonne bekomme ich meiner Wohnung auch nicht ab. Dafür klappe ich den Laptop wirklich nur zum Schlafen zu und checke noch spätnachts die Nachrichten am Smartphone. Und ja, den Facebook-Feed. Dort lese ich zum Beispiel, dass einige Frauen meinen, ihre Menstruation habe sich im Lockdown verkürzt. Zu den Monatsrhythmen wisse man noch nicht so viel, sagt Cajochen. Bekannt sind Studien, die besagen, dass sich der Zyklus von Frauen angleiche, wenn sie zusammenleben. Unter Stress dürfte er sich allerdings eher nach hinten verschieben. Vielleicht habe es was mit Pheromonen zu tun, die uns im Lockdown weniger um die Nase fliegen. Aber das sei reine Spekulation.
»Soziale Zeit gibt uns Struktur.«
Fest steht für ihn, dass es in der Quarantäne nicht ohne Selbstdisziplin geht. »Soziale Zeit ist natürlich nicht nur schlecht, sie gibt uns auch Struktur.« Wer nicht mehr zur Arbeit pendelt, sollte also morgens mal kurz raus in die Sonne, um die innere Uhr aufzuziehen. Das blaue Licht beim abendlichen Nachrichten- oder Netflix-Konsum sei natürlich weniger zuträglich. Allerdings steigt in der Krise das Informationsbedürfnis. Eine zweischneidige Sache: Zum Teil beruhigt uns, wenn wir uns Wissen aneignen in einer komplexen Situation. Ein Übermaß an schlechten Nachrichten kann aber auch den Stress erhöhen – und Stress ist Schlafkiller Nummer Eins.
Da ich Freiberuflerin bin, habe ich ohnehin einen seltsamen Schlafrhythmus, daran hat der Lockdown nicht viel geändert. Aber eins ist mir doch aufgefallen. Obwohl ich wenig erlebe, träume ich intensiv. »Das geht gerade vielen so, die ohne Wecker schlafen«, sagt Cajochen: »Wir wachen dann eher spontan aus der REM-Phase auf.« Das sind die Stunden, in denen sich die Hirnfrequenz beschleunigt, diese bescheren uns Albträume und auch luzide Träume.
»Wir werden ein Stück weit abgeschirmt, das erlaubt vielen, der inneren Uhr besser zu folgen.«
Als Chronobiologe sieht Cajochen aber auch einen Nutzen im Lockdown. »Wir werden ein Stück weit abgeschirmt, Pendel-Zeiten fallen weg, das erlaubt vielen Leuten, der inneren Uhr besser zu folgen. Es gibt schon Daten, dass die Schlafstunden zugenommen haben.« Jetzt gebe es auch die Möglichkeit, mal zu testen, wann man am besten schlafe. Und da viele Unternehmen nun auf die harte Tour verstehen mussten, dass das Homeoffice funktioniert, kann man den neu gesetzten Rhythmus vielleicht sogar nach der Krise weiterleben.
Professor Norman Sieroka hofft, dass wir uns des Zusammenhangs zwischen Eigenzeit und Weltzeit bewusster werden, und damit der Auswirkungen persönlicher Entscheidungen auf die Gesellschaft. »Wir merken jetzt, dass unsere Autonomie von ganz kleinen Dingen abhängt.« Vielleicht auch nur von der Entscheidung, wann wir einkaufen gehen.
Der Psychologe Marc Wittmann vergleicht die Zäsur mit dem Jahreswechsel, der für viele vielleicht sowieso noch nachklingt. »In den besinnlichen Tagen kehren wir uns nach innen, daraus resultieren die Neujahrsvorsätze.« Wir fühlen uns zurückgeworfen auf uns und machen uns Gedanken, wie wir eigentlich leben wollen. In der Coronakrise passiert das auch. Gleichzeitig denken wir viel an die anderen, wir spüren eine kollektive Erfahrung: »Und dabei merken wir, dass wir doch eigentlich sehr soziale Wesen sind.«
Erschienen am 08. Mai 2020