Das Coronavirus SARS-CoV-2 macht Nähe zur Gefahr. Dabei ist menschliche Nähe für uns überlebenswichtig und ein Mangel bedrohlich.
Seit Wochen zeigen Videos dir, wie du dir deine Hände richtig wäschst. Artikel und Experten sagen dir: Du sollst anderen Menschen nicht die Hand schütteln, du sollst sie nicht umarmen, ihnen generell nicht zu nahekommen. Du sollst so wenig wie möglich anfassen – auch nicht dein eigenes Gesicht. Vor allem nicht dein eigenes Gesicht.
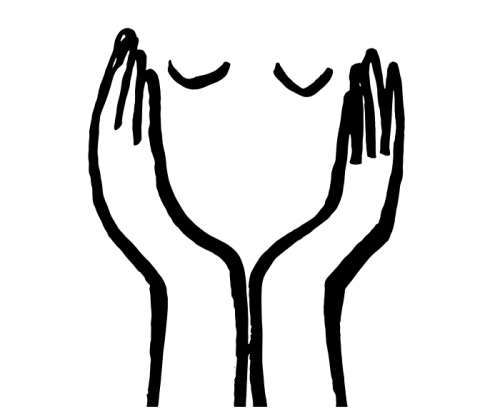
Du verstehst, warum. Du siehst die Sinnhaftigkeit der Empfehlungen ein. Coronaviren werden über Tröpfchen- und vermutlich auch Kontaktinfektion weitergegeben. Wenn du mit einer infizierten Person in Kontakt kommst, kann das Virus auf deine Hände gelangen. Und von dort an deine Schleimhäute, wenn du dir an Mund, Nase oder Augen fasst. Im Rachen kann sich SARS-CoV-2 festsetzen. Das Virus vermehrt sich. Ist das Immunsystem schwach, kann es sich bis in die Lunge ausbreiten.
Es liegt also in deiner Hand, ob sich das Virus weiter ausbreitet oder nicht. Doch deine Hand lässt sich nicht so einfach kontrollieren. Manchmal bewegt sie sich wie von selbst in dein Gesicht. Es gibt scheinbar keinen Auslöser dafür. Oft bemerkst du gar nicht, wie deine Finger über dein Gesicht streichen. Bis zu 800 Mal am Tag fasst du dir ins Gesicht – meistens in die Mitte zu Mund und Nase. Die Berührung dauert meist weniger als eineinhalb Sekunden lang.
Martin Grunwald, Leiter des Haptik-Forschungslabors am Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig, weiß warum. »Vor allem in sehr kurzen in Stresssituationen haben wir den Drang, uns ins Gesicht zu fassen. In EEG-Studien haben wir versucht herauszufinden, warum das so ist. Wir haben festgestellt: Nach einer Berührung des eigenen Gesichts ist die hirnelektrische Aktivität eine andere als davor. Die Berührung stabilisiert den emotionalen Zustand, schützt das Arbeitsgedächtnis vor Informationsverlust und stellt so eine psychische Balance her.«
Im Bauch der Mutter
Bereits im Bauch deiner Mutter hast du diesen Mechanismus genutzt. Wenn deine Mutter gestresst war, hast du dir häufiger ins Gesicht gefasst, weil dich das beruhigte. Deine Herzfrequenz verlangsamte sich. Doch warum steuern die Bewegungen der Hände ins Gesicht? Kann nicht auch eine Armberührung die psychische Balance wiederherstellen?
»Eine Berührung des Gesichts ist der schnellste Weg, um die Aktivität des Gehirns zu regulieren.«
Martin Grunwald
»Die Rezeptoren, also die Sinneszellen in der Gesichtshaut, sind extrem berührungssensibel und die elektrischen Impulse gelangen ohne Umleitung direkt ins Hirn. Eine Berührung des Gesichts ist der schnellste Weg, um die Aktivität des Gehirns zu regulieren«, sagt Martin Grunwald. »Hindert man Personen daran, sich ins Gesicht zu fassen, dann wird das Bedürfnis immer stärker.«
Warum die Berührungen meist auf die Mitte des Gesichts zielen, welche Unterschiede es gibt, wenn die rechte oder die linke Hand das Gesicht berührt, darauf haben Forscher noch keine Antwort. »Es gibt ganz viele Fragezeichen«, sagt Grunwald. Über das, was er weiß, hat er ein Buch geschrieben, Homo hapticus. Es erzählt, wie sich der Tastsinn im Menschen entwickelt, warum Körperkontakt überlebenswichtig ist und was ein Mangel an menschlichen Berührungen auslösen kann. Die Geschichte beginnt lange vor der Geburt.
Ab der siebten Schwangerschaftswoche hast du physische Einwirkungen auf deinen Körper wahrgenommen. In der zehnten Woche hast du angefangen, dich zu berühren, vor allem dein Gesicht. In der siebzehnten Woche sind fünf Millimeter lange Haare auf deinem Körper gewachsen. Jede Krümmung dieser Lanugohärchen löste eine Kette von Reaktionen aus: Die tastsensiblen Zellen in deiner Haut leiteten elektrische Impulse an dein Hirn, unter anderem in den Inselkortex. Dort wurden Hormone freigesetzt, die über die Nerven in die Peripherie des Körpers gelangten, unter anderem das Bindungshormon Oxytocin. Dadurch verringerte sich deine Atemfrequenz, der Blutdruck sank, die Blutgefäße erweiterten und die Muskeln entspannten sich. Ab der 33. Schwangerschaftswoche haben sich die Lanugohärchen zurückgebildet.
Der Tastsinn ist der erste Sinn des Menschen. Er hilft dir, eine Vorstellung von deinem Körper zu entwickeln, das Körperschema. Nach der Geburt hat der Tastsinn dafür gesorgt, dass du dich anpassen konntest an die neue Umgebung außerhalb des Körpers deiner Mutter.
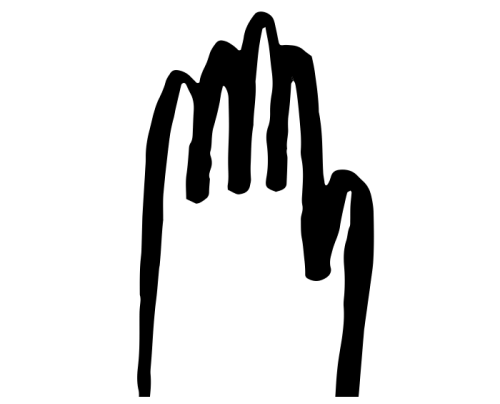
In deinem Körper sitzen mehr als 710 Millionen tastsensible Rezeptoren, die in jeder Sekunde Milliarden von elektrischen Impulsen über die Nerven und das Rückenmark an dein Hirn senden – auch wenn sie nicht gereizt werden. Darum weißt du immer Bescheid, wo deine Arme und Beine sind, wie stark deine Muskeln gespannt sind, du weißt, dass deine Beine fest auf dem Boden stehen und deine Finger über den Bildschirm deines Handys scrollen.
Damit du deine Muskeln bewegen kannst, damit du nicht in der Hitze verbrennst und Umarmungen fühlen kannst, sind jede Menge verschiedener Rezeptoren am Werk mit unterschiedlichen Aufgaben. So registrieren etwa die freien Nervenendigungen Schmerz, Temperatureinwirkung, gewebeschädigende chemische Einflüsse und leichte Berührungsreize, Muskelspindeln erkennen den Spannungszustand jedes Muskels und Golgi-Sehnen-Organe den Dehnungszustand der Sehnen.
Der erste Sinn
Hast du dich mal gefragt, auf welches Sinnesorgan könntest du am ehesten verzichten könntest? Auf den Geruchssinn vielleicht, sicher nicht auf Sehen und Hören. An den Tastsinn hast du wohl gar nicht gedacht. Doch ohne den Tastsinn könntest du nicht überleben. Du brauchst Berührungen, um zu wachsen, weil Körperkontakt Wachstumsprozesse anstößt – auch in Nervenzellen. Doch in jeder Berührung steckt auch eine Gefahr. Darum brauchst du Zellen im Körper, die Schmerz registrieren, und du brauchst Bereiche im Gehirn, die ihn als solchen interpretieren. Der Neurobiologe David Linden sagt in einem TED-Talk: Es gibt kein Fühlen ohne Gefühl.
Das liegt daran, dass zwei Hirnsysteme gleichzeitig arbeiten: Druck, Berührung und Schmerz werden auf der äußeren Schicht des Großhirns repräsentiert, der Großhirnrinde. Diese besteht aus verschiedenen Teilen, einer davon ist der somatosensorische Cortex, ein anderer die Inselrinde. In der posterioren Inselrinde wird Berührung emotional bewertet. Im somatosensorischen Cortex werden Fakten verarbeitet: Wo und wie stark wirst du berührt? Menschen, bei denen die Funktion des somatosensorischen Cortex gestört ist, können keine Schmerzen empfinden. Auch wenn sie nach einem Schlag auf den Arm »Aua« rufen, ist es ihnen unmöglich zu verorten, woher der Schmerz kommt.
Nähe bedeutet Überleben
Du hast bereits als Kind weiche und warme Berührungen mit einem positiven Gefühl verknüpft. Denn die menschliche Nähe garantiert, dass jemand da ist und sich kümmert, alleine ist ein Säugling hilflos. Nähe bedeutet Überleben. Fehlt nach der Geburt diese körpersprachliche Versicherung, signalisiert der Organismus: Es macht keinen Sinn, die Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Hat der Säugling aber direkt nach der Geburt Hautkontakt zur Mutter, kann er den Stress der Geburt besser verarbeiten. Das erste Schreien dauert dann weniger lange, als wenn das Kind nicht die Haut der Mutter berühren kann.
Fehlt einem Kleinkind der Kontakt zu anderen Menschen, kann es das verunsichern, es reagiert aggressiv, schläft schlecht, entwickelt sich langsamer als seine Altersgenossen. Diese Erkenntnisse stammen vor allem aus Tierversuchen. Einer der bekanntesten ist wohl der Versuch an Rhesusaffen von Harry Harlow. Der Psychologe isolierte Affenjunge und setzte sie in einen Käfig mit zwei Attrappen als Mutterersatz: eine Drahtattrappe mit Milchflasche und eine weiche Stoffattrappe. Die Äffchen gingen nur zur Nahrungsaufnahme zur Drahtattrappe und kuschelten sich in der restlichen Zeit an die Stoffattrappe. Doch auch die Stoffattrappe konnte die Mutter nicht ersetzen. Die meisten Tiere entwickelten sich nicht normal, sie verhielten sich aggressiv oder waren apathisch. Viele von ihnen waren paarungsunfähig oder nicht in der Lage, eigene Junge großzuziehen.
Zum Sterben ins Kinderheim
In einem ehemaligen Jagdschloss in Rumänien, nahe der Grenze zu Ungarn, zeigte sich auf grausame Weise, wie sehr auch Menschen Berührungen brauchen, vor allem Kinder. In den 1970er-Jahren wurden Kinder zum Sterben hierher ins Kinderheim Cighid gebracht. Der Diktator Nicolae Ceaușescu wollte damals die Einwohnerzahl des Landes erhöhen, mit drastischen Mitteln: Eltern, die weniger als fünf Kinder hatten, verbot er Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsabbruch. Viele Mütter versuchten darum selbst, die Schwangerschaft mithilfe von Medikamenten oder Drähten abzubrechen – viele Kinder kamen mit geistigen und körperlichen Behinderungen zur Welt. Die Schwächsten kamen in Heime, wo sie verhungerten und erfroren. All das kannst du dir in einer Reportage von Spiegel-TV aus den Neunzigern anschauen. Am liebsten würdest du die Bilder gleich wieder vergessen. Du siehst Kinder, die schreien, sich ungelenk bewegen und sich selbst schlagen. Kinder, die gehalten werden wie Tiere in kalten Räumen. Du hörst eine Ärztin, die sagt: Sie bräuchten Menschlichkeit.
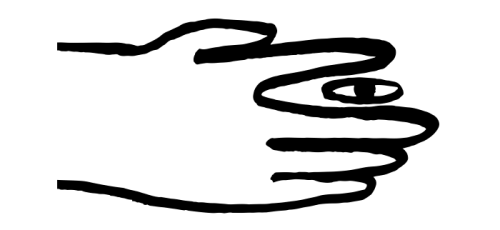
David Linden erklärt: Kinder, die nicht gehalten oder umarmt werden, entwickeln Bindungsstörungen, ihre kognitiven Fähigkeiten sind verzögert, ihr Immunsystem ist schwach. Dabei braucht es nicht viel, diese negativen Folgen zu vermeiden: Dazu müssen die Kinder nur 30 Minuten am Tag umarmt und gehalten werden – in den ersten zwei Lebensjahren. Danach ist es zu spät und die Folgen sind irreversibel. Linden sagt: Berührungen sind sozialer Klebstoff.
Als Erwachsener fühlst du dich unwohl, wenn dir der Kontakt zu anderen Menschen fehlt. Das kann sich steigern zu Depression und Burnout, und sich auch körperlich zeigen in Muskelverspannungen oder Bauchschmerzen. Du versuchst dann, den Mangel zu kompensieren – mit Alkohol vielleicht, Drogen, Sport.
Aber eines kannst du dir nicht selbst geben: Nähe. Selbstumarmungen haben nicht den gleichen Effekt wie Fremdberührungen. Weil dein Gehirn parallel ein Protokoll deiner Handlungen erstellt. Es registriert, dass du selbst es bist, der dich umarmt. Dann hemmt es die Informationsbahnen zur posterioren Insula. Die Berührung wird nicht emotional bewertet.
»Das Virus ist wie ein zusätzlicher Verbraucher an unserem neuronalen Stromnetz, das ständig Energie abzapft.«
Martin Grunewald
Doch zurzeit bleibt dir keine Wahl. Das Coronavirus hat sich auf die Normalität des Lebens gelegt. Der Tastsinn-Forscher Martin Grunwald sagt dazu: »Das Virus beunruhigt uns, vor allem unbewusst. Es ist wie ein zusätzlicher Verbraucher an unserem neuronalen Stromnetz, das ständig Energie abzapft. Zudem passieren gerade sensorisch wundersame Dinge. Ich wohne zum Beispiel an einer Hauptstraße, zurzeit aber habe ich eher das Gefühl, als lebte ich in einem brandenburgischen Dorf. Ich habe noch nie so viele Vögel gehört, noch nie hat es in der Stadt so sehr nach Land gerochen. Sogar meine Heimat kommt mir ungewohnt vor.«
Niemand weiß, wie es weitergeht, wann sich der Zustand wieder ändert, wann sich Menschen wieder in größeren Gruppen treffen dürfen. »Körperkontakt ist in uns eingebrannt, deswegen erfinden wir so lustige Begrüßungsrituale wie Schienbein an Schienbein. Dieser Mangel an sozialen Kontakten ist extrem bedrohlich«, sagt Grunwald. »Umso wichtiger ist es, die einfachen Dinge des Alltags in Wunder aufzuspalten und alle Sinne zu beanspruchen. Ich versuche zum Beispiel, beim Duschen quasi jeden Tropfen warmen Wassers bewusst wahrzunehmen.«
Was kannst du also tun, um die Krise zu überstehen? Geh raus und versuch an was anderes zu denken als an das Virus, versuche jeden Tag was Neues zu kochen, mit möglichst vielen Gewürzen, die deinen Geruchs- und deinen Geschmackssinn erfreuen, höre den Frühling durchs Geäst flattern und sieh zu, wie es von Tag zu Tag grüner wird. Deinen Tastsinn kannst du immer noch aktiv dazu benutzen, um mit deinem Finger dein Smartphone zu entsperren. So kannst du zumindest über Anrufe und soziale Medien mit anderen Menschen den Kontakt halten.
Erschienen am 08. Mai 2020