Eva ist schwer krank, sie kann nicht laufen, nicht sprechen. Wegen einer seltenen Erbkrankheit, die die Forschung vor viele Fragen stellt, ist ihr Kleinhirn nicht voll entwickelt. Helfer:innen wollen zeigen, was trotzdem möglich ist. Ihr Ziel: eine Berghütte auf 2.000 Metern.
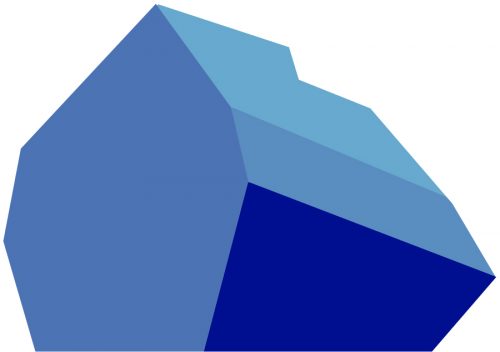 An diesem Herbstmorgen wirkt Eva wie eine kleine Prinzessin. Mal zufrieden, mal staunend blickt sie auf die vier Helfer:innen an den Seiten ihrer Sänfte.Eigentlich ist es gar keine Sänfte. Eva sitzt in einem Joëlette – einem einrädrigen Rollstuhl mit Federung und Elektromotor, entwickelt für den Einsatz in unwegsamen Regionen. Aber auf Wegen voller Steine und Wurzeln nützt eine Motorisierung wenig. Darum werden Freund:innen, Eltern und Pfleger:innen Eva später mit ihrem Rolli tragen, wie in einer Sänfte.
An diesem Herbstmorgen wirkt Eva wie eine kleine Prinzessin. Mal zufrieden, mal staunend blickt sie auf die vier Helfer:innen an den Seiten ihrer Sänfte.Eigentlich ist es gar keine Sänfte. Eva sitzt in einem Joëlette – einem einrädrigen Rollstuhl mit Federung und Elektromotor, entwickelt für den Einsatz in unwegsamen Regionen. Aber auf Wegen voller Steine und Wurzeln nützt eine Motorisierung wenig. Darum werden Freund:innen, Eltern und Pfleger:innen Eva später mit ihrem Rolli tragen, wie in einer Sänfte.
Ein Donnerstag im September am Bahnhof Randa, 15 Autominuten nördlich von Zermatt. Eva (18) und ihre Schwester Jana (16) starten zu einem der größten Abenteuer, das die zwei bislang erlebt haben. Der Bahnhofsvorplatz liegt schon hinter ihnen, noch schieben die Helfer. Allmählich werden die Häuser kleiner, die Straße verwandelt sich in einen Feldweg, um später in einen Gebirgssteig zu münden. Wiesen und Wälder wechseln sich ab, die Luft wird kühler, der Aufstieg steiler. »Geht es dir gut?«, fragt Michael Ledergerber seine Tochter. Eva hebt den Kopf und strahlt. Wie viele Kinder in ihrer Lage reagiert sie auf Berührungen, Musik, Sonne, frische Luft. Dann schließt sie manchmal die Augen, wirkt entspannt, weil das Zittern weniger wird, das ihren schmalen Körper nahezu ununterbrochen zucken lässt. Manchmal huscht sogar ein Lächeln über ihr Gesicht.
 Jana und Eva leben im schweizerischen Luzern, sie besuchen dort eine Sonderschule für Menschen mit schweren Behinderungen. Die Mädchen leiden unter Pontozerebellärer Hypoplasie, Typ 2 (PCH-2), einer seltenen Erbkrankheit, bei der das Kleinhirn unterentwickelt ist. Auf etwa eine Million Geburten kommt ein erkranktes Kind.
Jana und Eva leben im schweizerischen Luzern, sie besuchen dort eine Sonderschule für Menschen mit schweren Behinderungen. Die Mädchen leiden unter Pontozerebellärer Hypoplasie, Typ 2 (PCH-2), einer seltenen Erbkrankheit, bei der das Kleinhirn unterentwickelt ist. Auf etwa eine Million Geburten kommt ein erkranktes Kind. 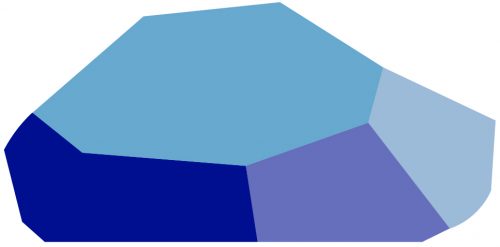 Die Betroffenen können nicht laufen, nicht sprechen, einige nicht einmal schlucken. Ständige Unruhe, Krämpfe und epileptische Anfälle gehören zum Alltag. Viele Kinder sterben vor ihrem zehnten Geburtstag, oft plötzlich und unerwartet in der Nacht, meist an Krampfanfällen, bei denen die Atmung aussetzt, im Rahmen einer schweren Infektion an zu niedriger Körpertemperatur oder an Multiorganversagen. Deshalb ist Überwachung und Pflege rund um die Uhr nötig. Weil weltweit wenig verbreitet, ist PCH-2 kaum ein Thema für Wissenschaft und Pharmaindustrie. In Deutschland versucht die Elterninitiative PCH-Familie, auf die Situation ihrer Kinder aufmerksam zu machen. Auch mit spektakulären Aktionen.
Die Betroffenen können nicht laufen, nicht sprechen, einige nicht einmal schlucken. Ständige Unruhe, Krämpfe und epileptische Anfälle gehören zum Alltag. Viele Kinder sterben vor ihrem zehnten Geburtstag, oft plötzlich und unerwartet in der Nacht, meist an Krampfanfällen, bei denen die Atmung aussetzt, im Rahmen einer schweren Infektion an zu niedriger Körpertemperatur oder an Multiorganversagen. Deshalb ist Überwachung und Pflege rund um die Uhr nötig. Weil weltweit wenig verbreitet, ist PCH-2 kaum ein Thema für Wissenschaft und Pharmaindustrie. In Deutschland versucht die Elterninitiative PCH-Familie, auf die Situation ihrer Kinder aufmerksam zu machen. Auch mit spektakulären Aktionen.

An diesem Donnerstag bricht eine 30-köpfige Truppe auf zu einer Berghütte in 2.265 Metern Höhe. Mit dabei sind auch die Söhne von Axel Lankenau. Jonas (16) und Felix (14) leiden ebenfalls an PCH-2. Ihr Vater sagt: »Wir wollen zeigen, dass es mit schwerbehinderten Kindern möglich ist, scheinbar unmögliche Dinge zu schaffen.« Neben ihm steht Wibke Janzarik. Die promovierte Neurologin und Kinderärztin am Uniklinikum Freiburg gehört zu der Handvoll Wissenschaftler:innen hierzulande, die zu PCH-2 forschen. Sie sagt: »Lebensqualität hängt nicht vom Grad der Behinderung ab.« Wichtig sei es, Leiden zu lindern und Wohlfühlmomente zu schaffen.
 Irgendwo an Evas Rollstuhl piepst es. Zwei Stunden sind die vier Kinder und ihre Betreuer:innen jetzt unterwegs. In immer kürzeren Abständen wechseln sich die Helfer:innen an den Joëlette ab. Nun müssen sie pausieren. »Die Nährflüssigkeit ist alle«, sagt Evas Vater. Es muss schnell gehen. Mit geübten Griffen wechselt er den Kunststoffbeutel, verbindet ihn mit dem Schlauch, der in Evas Bauch führt.
Irgendwo an Evas Rollstuhl piepst es. Zwei Stunden sind die vier Kinder und ihre Betreuer:innen jetzt unterwegs. In immer kürzeren Abständen wechseln sich die Helfer:innen an den Joëlette ab. Nun müssen sie pausieren. »Die Nährflüssigkeit ist alle«, sagt Evas Vater. Es muss schnell gehen. Mit geübten Griffen wechselt er den Kunststoffbeutel, verbindet ihn mit dem Schlauch, der in Evas Bauch führt.
»Sonden, die durch die Bauchdecke direkt in den Magen eingeführt werden, gehören zu den Fortschritten der vergangenen Jahre, mit denen wir das Leben der Kinder verlängern können«, sagt Ingeborg Krägeloh-Mann. »Denn viele Patienten können wegen Schluckproblemen weder selbst Nahrung zu sich nehmen noch gefüttert werden.« Die Ärztin für Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie leitete jahrelang die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uni Tübingen. 2004 sah sie zum ersten Mal auf einer Aufnahme aus dem Magnetresonanztomografen (MRT) das extrem verkleinerte Kleinhirn eines Kindes, dessen Hirnhälften an Flügel einer Fledermaus erinnerten. Sie sagt: »Wenn man das einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr vergessen.«
»Wenn man das einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr vergessen.«
 Auslöser der Krankheit ist eine einzige Mutation auf einem einzigen DNA-Baustein: Im Gen TSEN54 steht anstelle einer Guanin-Base nun der Baustein Thymin. Die Eltern wissen vor der Geburt meist gar nichts von diesem Gendefekt, den sie ihren Kindern möglicherweise vererben. Relativ viele Menschen tragen diese Mutation, bei der ein Chromosom des betroffenen Chromosomenpaars normal ausgeprägt und das andere Chromosom verändert ist. Konsequenzen hat das zunächst keine. Zeugen jedoch zwei Menschen, die zufällig beide diese Mutation auf einem ihrer Chromosomen tragen, ein Kind, kann es PCH-2 bekommen – die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 25 Prozent. Autosomal-rezessive Vererbung heißt dieser Vorgang. Wer wissen will, wie es zu dieser Mutation kam, muss mehr als 350 Jahre zurückblicken.
Auslöser der Krankheit ist eine einzige Mutation auf einem einzigen DNA-Baustein: Im Gen TSEN54 steht anstelle einer Guanin-Base nun der Baustein Thymin. Die Eltern wissen vor der Geburt meist gar nichts von diesem Gendefekt, den sie ihren Kindern möglicherweise vererben. Relativ viele Menschen tragen diese Mutation, bei der ein Chromosom des betroffenen Chromosomenpaars normal ausgeprägt und das andere Chromosom verändert ist. Konsequenzen hat das zunächst keine. Zeugen jedoch zwei Menschen, die zufällig beide diese Mutation auf einem ihrer Chromosomen tragen, ein Kind, kann es PCH-2 bekommen – die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 25 Prozent. Autosomal-rezessive Vererbung heißt dieser Vorgang. Wer wissen will, wie es zu dieser Mutation kam, muss mehr als 350 Jahre zurückblicken.
Das niederländische Fischerdorf Volendam, 20 Kilometer nördlich von Amsterdam im 17. Jahrhundert: Während überall im Land die Reformationsbewegung Kirche und Gesellschaft verändert, widersetzen sich die Bewohner der Erneuerung, beharren auf ihrem traditionellen katholischen Glauben. Im Laufe der Jahre isoliert sich das Dorf von den umliegenden Gemeinden; die Zahl potenzieller Partner schrumpft, es heiraten nahe Verwandte, was den Genpool immer weiter verkleinert. Zu dieser Zeit trat erstmalig die Mutation auf. Das ergaben Forschungen des niederländischen Neurologen Peter P. Barth. 1995 analysierte er fünf Familien mit PCH-2, die alle aus Volendam stammen. Barth zufolge haben die meisten Erkrankten in Europa einen gemeinsamen Vorfahren – einen Mann, der im 17. Jahrhundert in Volendam gelebt hat.


Heilung gibt es bis heute nicht, nur unterstützende Behandlungen wie Magensonden, Physiotherapie, Medikamente gegen Epilepsie und Krampfanfälle oder Geräte, die die Atmung im Schlaf überwachen. Mittlerweile können Ärzte PCH-2 bereits während der Schwangerschaft diagnostizieren, indem sie der werdenden Mutter Fruchtwasser entnehmen und molekulargenetisch untersuchen. »Doch das macht man bislang nur als Screening, wenn bereits ein Geschwisterkind betroffen ist. Denn PCH-2 tritt sehr viel seltener auf als etwa die Erbkrankheit Trisomie 21«, sagt Ärztin Krägeloh-Mann.
Vor anderthalb Jahrzehnten gab es diese Möglichkeit der Früherkennung noch nicht, die genetischen Grundlagen von PCH-2 waren damals noch nicht bekannt. Bei Jana aus Luzern und Felix aus Bremen, den jüngeren Geschwistern von Eva und Jonas, verliefen die Schwangerschaften unauffällig. Selbst nach der Geburt der beiden glaubten die Eltern, diesmal gesunde Kinder bekommen zu haben. Erst viele Monate später wurden Symptome sichtbar.
Behutsam bugsieren die Helfer:innen vier Rollstühle durch das schwankende Nadelöhr.
Es ist kurz vor 15 Uhr, als der Trampelpfad vor einer Schlucht endet. Eine Hängebrücke ist die einzige Möglichkeit, auf die andere Seite zu gelangen. Auf fast 500 Metern spannt sich die Stahlkonstruktion über das Tal, nur ein Gitterrost unter den Füßen, kaum mehr als einen halben Meter breit, trennt Wagemutige vom Abgrund in 85 Metern Tiefe. Behutsam bugsieren die Helfer:innen vier Rollstühle durch das schwankende Nadelöhr. Eine halbe Stunde später haben alle wieder festen Boden unter sich. Die Berghütte ist nicht mehr weit.
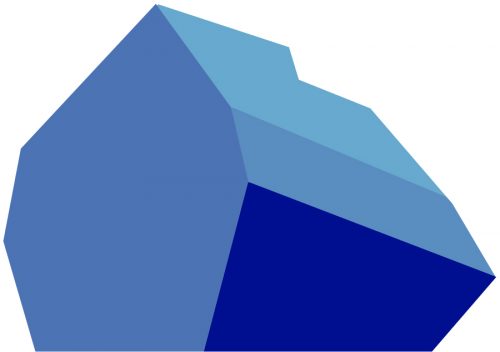 Plötzlich verschwindet der Weg. Wo sich eben noch ein Pfad Richtung Gipfel schlängelte, erstreckt sich nun eine graue Geröllwüste, meterhohe Steine stoppen die Karawane, das Knirschen unter den Bergstiefeln verstummt. Aus einem wolkenlosen Himmel wirft die Sonne ihre Strahlen auf die Walliser Alpen; Bäume, die Schatten spenden, sucht man in mehr als 2.000 Metern Höhe vergebens. Erschöpft wuchten die Frauen und Männer ihre Rücksäcke von den Schultern, hocken sich auf Felstrümmer, saugen die letzten Tropfen aus ihren Wasserflaschen. Nur Eva hält das Gesicht verzückt in die Sonne und wedelt mit den Händen. Dass sie bis hierhergekommen ist, gleicht einem kleinen Wunder. Doch die schwierigste Etappe steht noch bevor.
Plötzlich verschwindet der Weg. Wo sich eben noch ein Pfad Richtung Gipfel schlängelte, erstreckt sich nun eine graue Geröllwüste, meterhohe Steine stoppen die Karawane, das Knirschen unter den Bergstiefeln verstummt. Aus einem wolkenlosen Himmel wirft die Sonne ihre Strahlen auf die Walliser Alpen; Bäume, die Schatten spenden, sucht man in mehr als 2.000 Metern Höhe vergebens. Erschöpft wuchten die Frauen und Männer ihre Rücksäcke von den Schultern, hocken sich auf Felstrümmer, saugen die letzten Tropfen aus ihren Wasserflaschen. Nur Eva hält das Gesicht verzückt in die Sonne und wedelt mit den Händen. Dass sie bis hierhergekommen ist, gleicht einem kleinen Wunder. Doch die schwierigste Etappe steht noch bevor.
400 Kilometer weiter nördlich hat Simone Mayer ebenfalls noch viele Hindernisse vor sich, bis sie ihr Ziel erreicht. Die promovierte Molekularbiologin leitet seit 2018 eine Forschungsgruppe an der Uni Tübingen, die zu entschlüsseln versucht, wie und warum die Mutation eines einzigen Gens das Kleinhirn so schwer schädigt. Als Mayer vor drei Jahren nach Tübingen kam, lernte sie die damalige Direktorin der Uni-Kinderklinik kennen. Ingeborg Krägeloh-Mann sagte damals zu ihr: »Wir betreuen schon lange PCH-2-Patienten therapeutisch, wissen aber nichts über den Mechanismus dieser Krankheit.« Simone Mayer sah ein großes Potenzial darin, Ansätze aus der Stammzellforschung zu nutzen, um diese seltene Erkrankung besser verstehen zu lernen.

Mediziner:innen der Kinderklinik entnehmen den kleinen Patient:innen ein winziges Stück Haut. Mayer und ihre Kolleg:innen geben die Proben dann in Petrischalen mit Nährlösung, wo daraus neue Hautzellen wachsen. Anschließend verändern die Forscher:innen die Zusammensetzung der Nährlösung und signalisieren den Hautzellen damit, dass sie sich in Stammzellen verwandeln sollen. »Wir geben unter anderem bestimmte Wachstumsfaktoren hinzu, außerdem Energieträger und spezielle Puffer, die den pH-Wert konstant halten.« Die Stammzellen werden in einem nächsten Schritt auf ähnliche Weise umprogrammiert, bis sie sich zu Kleinhirnzellen ausdifferenzieren. Diese Prozedur dauert Monate. Ist das geschafft, vergleicht Mayers Team die im Labor gezüchteten Nervenzellen mit denen gesunder Kinder. So wollen die Forscher:innen herausfinden, wie sich die Genmutation auf die Nervenzellen des Kleinhirns auswirkt. Mayer sagt: »Wir schauen beispielsweise, ob sich die Stammzellen von Erkrankten weniger oft teilen, ob sie bestimmte Nervenzellen weniger ausbilden oder die fertigen Nervenzellen eine andere Form haben als bei gesunden Menschen.«
 Was die Wissenschaftlerin schon von anderen Genetikern weiß: Das mutierte Gen, TSEN-54, liefert Anweisungen zur Herstellung eines Enzymteils, das nötig ist zur Verarbeitung von speziellen Transfer-Ribonukleinsäuren (t-RNA). Die t-RNA-Moleküle werden ihrerseits für die Zusammensetzung von Eiweißbausteinen gebraucht. »Wenn wir herausfinden, was bei dieser Umwandlung von t-RNA zu Proteinen schiefläuft, können wir vielleicht Rückschlüsse ziehen, warum das Kleinhirn so stark betroffen ist und andere Regionen nicht.«
Was die Wissenschaftlerin schon von anderen Genetikern weiß: Das mutierte Gen, TSEN-54, liefert Anweisungen zur Herstellung eines Enzymteils, das nötig ist zur Verarbeitung von speziellen Transfer-Ribonukleinsäuren (t-RNA). Die t-RNA-Moleküle werden ihrerseits für die Zusammensetzung von Eiweißbausteinen gebraucht. »Wenn wir herausfinden, was bei dieser Umwandlung von t-RNA zu Proteinen schiefläuft, können wir vielleicht Rückschlüsse ziehen, warum das Kleinhirn so stark betroffen ist und andere Regionen nicht.«
Mayers Forschung kommt nicht nur PCH-2-Kindern zugute, sondern vertieft auch das Wissen über die frühe Entwicklung unseres Gehirns. Möglicherweise spiele dieser oder ähnliche Gendefekte auch bei anderen Krankheiten eine Rolle. Und mittlerweile sei die medizinische Forschung so spezialisiert, dass sie immer mehr Untervarianten von bekannten Krankheiten klassifiziert und deren Ursachen untersucht, etwa von Alzheimer oder Brustkrebs. »Die Forschung wird kleinteiliger«, sagt Mayer. Somit ist die Forschung an seltenen Erkrankungen modellhaft auch für häufigere Defekte.
Steine, Steine, Steine. Soweit das Auge reicht.
Mitten in den Alpen stehen die Abenteurer aus Deutschland und der Schweiz vor weit größeren Problemen – größer als die Moleküle in Mayers Labor: Steine, Steine, Steine. Soweit das Auge reicht. Unklar, wie Eva, Jana, Jonas und Felix mit ihren Vehikeln dieses Terrain durchqueren sollen. Für Axel Lankenau sind die Steine sinnbildlich für den Alltag mit schwerbehinderten Kindern. Er sagt: »Wir sind nie auf der Autobahn unterwegs, sondern müssen ständig Hindernisse beiseite räumen oder große Klötze mit viel Kraft überschreiten.«
 Die Helfer:innen packen die Rollstühle und heben sie über jeden einzelnen Brocken. Kurz nach 17 Uhr erreicht der letzte Rolli die Europahütte. Die Sonne verschwindet hinter schneebedeckten Gipfeln, die vier Jugendlichen wirken erschöpft, aber glücklich. Michael Ledergerber sagt: »Jana und Eva hatten definitiv Spaß, und das ist für mich das wichtigste.« Axel Lankenau erklärt: »Jonas und Felix waren mal fröhlich, mal nicht so gut drauf – wie im normalen Leben auch.« Weit nach Mitternacht erlöschen die Lichter. Am kommenden Morgen beginnt der Abstieg ins Tal.
Die Helfer:innen packen die Rollstühle und heben sie über jeden einzelnen Brocken. Kurz nach 17 Uhr erreicht der letzte Rolli die Europahütte. Die Sonne verschwindet hinter schneebedeckten Gipfeln, die vier Jugendlichen wirken erschöpft, aber glücklich. Michael Ledergerber sagt: »Jana und Eva hatten definitiv Spaß, und das ist für mich das wichtigste.« Axel Lankenau erklärt: »Jonas und Felix waren mal fröhlich, mal nicht so gut drauf – wie im normalen Leben auch.« Weit nach Mitternacht erlöschen die Lichter. Am kommenden Morgen beginnt der Abstieg ins Tal.
Erschienen am 24. März 2022
