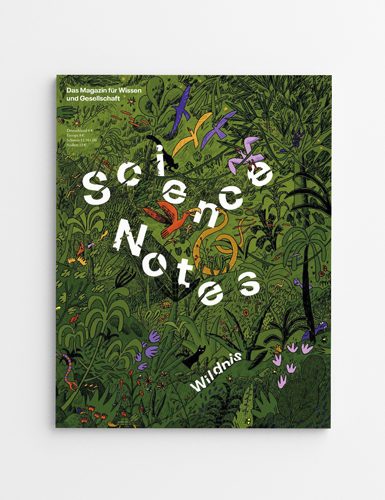Für Darwin war klar: Es verstreichen Äonen, bis die Evolution ihr Werk vollbracht hat. Doch heute beobachtet der Biologe Menno Schilthuizen eine wahre Turbo-Evolution – besonders in Großstädten. Ein virtueller Stadtspaziergang.
Wenn Menno Schilthuizen zu einer Expeditionsreise aufbricht, braucht er keinen Tropenanzug. Im grauen Tweedjacket tritt er vor die Haustür, wendet sich nach rechts und biegt in den Weddesteeg ein. Diese Gasse im niederländischen Städtchen Leiden führt von der Altstadt direkt zum Rhein. Schilthuizen nimmt uns per Videochat mit, geht an Rembrandts Geburtshaus und an einem kleinen Café vorbei, überquert eine Hängebrücke – und hört es prompt krächzen und kreischen. Leuchtend grüne Vögel mit roten Schnäbeln turnen in einem Bäumchen herum. Schilthuizen freut sich: so ein plakatives Beispiel für seine Forschung, direkt vor der Nase. »Das sind die Leidener Halsbandsittiche. Früher waren sie als exotische Käfigvögel beliebt, heute leben sie verwildert in vielen europäischen Städten.«

Die Stadt Leiden liegt in einem Winkel der Welt, der seit Jahrtausenden vor allem von menschlichem Gewusel geprägt ist. Wie für alte, hübsche Städte typisch, ist sie eine Art Wüste aus Kopfsteinpflaster, Stufengiebeln und Backsteinhäusern. Nachts bestrahlen Laternen die Straßen mit künstlichem Licht, tagsüber lärmen die Touristen. Aber machen diese Eigenschaften Städte nicht automatisch zu einem lebensfeindlichen Ort für Tiere und Pflanzen?
Evolution im Schnelldurchlauf
Der Biologe Schilthuizen vertritt exakt die gegenteilige These: Die Stadt ist der neue Motor der Evolution. Wie er sagen immer mehr Forscher:innen, dass wir in den Städten überall auf der Erde derzeit einer beeindruckenden Entwicklung zusehen können – der Entstehung neuer Arten im Schnelldurchlauf.
Der 55-Jährige ist Professor für Evolutionsbiologie am Naturalis Biodiversitätszentrum in Leiden und in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnlicher Wissenschaftler. Er hat früh erkannt, dass Wissenschaft Publikum braucht: »Es ist mir ein Anliegen, anderen Menschen Forschung über die Artenvielfalt nahezubringen; auch denen, die damit eigentlich nichts am Hut haben.« Deshalb schreibt er populärwissenschaftliche Bücher, organisiert Expeditionen und betreibt Forschungsprojekte, an denen alle Bürger:innen teilnehmen dürfen.
2030 wird knapp ein Zehntel der Landmasse verstädtert sein.
Ein Grund für dieses Engagement sind auch Erfahrungen aus seiner Kindheit im Speckgürtel von Rotterdam, eine damals noch weitgehend ländliche Gegend. Als Junge stapfte Schilthuizen über Teppiche aus jungem Knabenkraut, bewaffnet mit Feldstecher und Fotoapparat, er fotografierte Vögel und fing Käfer. Doch als Rotterdam wucherte und nur wenige Jahre später die Bulldozer seinen Abenteuerspielplatz planierten, »da kochte ich vor Wut«. Die Menschen hätten nicht verstanden, was es dort zu erhalten gelte.
 Genauso gilt es aber auch urbane Ökosysteme zu verstehen und wertzuschätzen, findet Schilthuizen. Denn sie werden bald die Erde dominieren: Mitte des 21. Jahrhunderts werden zwei Drittel aller geschätzten 9,3 Milliarden Menschen weltweit in Städten leben. Und spätestens 2030 wird knapp ein Zehntel der Landmasse des Planeten verstädtert und der Rest mit Farmen, Weiden und Plantagen überzogen sein.
Genauso gilt es aber auch urbane Ökosysteme zu verstehen und wertzuschätzen, findet Schilthuizen. Denn sie werden bald die Erde dominieren: Mitte des 21. Jahrhunderts werden zwei Drittel aller geschätzten 9,3 Milliarden Menschen weltweit in Städten leben. Und spätestens 2030 wird knapp ein Zehntel der Landmasse des Planeten verstädtert und der Rest mit Farmen, Weiden und Plantagen überzogen sein.
Und so nutzt Schilthuizen sein Talent, Geschichten zu erzählen, um den Menschen die erstaunliche Anpassungsfähigkeit und Kraft des Lebens deutlich zu machen – auch und gerade in ihrer direkten Nähe, die manchen reizlos erscheinen mag.
Von der Carnaby Street in die Freiheit
In seinem Buch Darwin in der Stadt hat er eine Reihe von Beispielen für die Anpassung von Tieren und Pflanzen an das Stadtleben zusammengetragen. Die Leidener Halsbandsittiche sind eines davon. Ursprünglich stammen die Vögel aus Indien und Afrika. In Indien bevölkern sie auch niedrig gelegene Teile des Himalayas und sind deshalb moderate Kälte gewohnt – so kamen sie in Mitteleuropa bestens zurecht, wenn sie aus ihren Käfigen ausbüxten. Ein popkulturelles Detail: Den Grundstock für die riesige Londoner Kolonie soll Jimi Hendrix gelegt haben, der in den 60-ern ein Paar in der Carnaby Street in die Freiheit entließ.
Schilthuizen selbst erforscht die Evolution am Beispiel der Schnirkelschnecke – ein derart allgegenwärtiges Tier, dass man es in Europa beinahe an jeder Ecke und inzwischen auch in Übersee vorfindet. Auch jetzt sammelt Schilthuizen an den Rändern der Kopfsteingasse immer wieder Schneckenhäuser auf und hält sie ins Licht. »Normalerweise sind die Häuser der Schnirkelschnecken rötlich bis dunkelbraun.« Doch vor einigen Jahren entdeckte er einige Individuen der Cepaea nemoralis, die anders waren. Die Weichtiere erregten seine Aufmerksamkeit, weil sie ihm immer wieder die Zierpflanzen in seinem Vorgarten wegfraßen. Als er sie von den Ästen pulte, bemerkte er ihre seltsame Farbe. »Die Häuser der Schnirkelschnecken in meinem Garten sind fahlgelb mit ein paar dunklen Streifen darauf. Noch vor zwanzig Jahren war das sehr ungewöhnlich.«
»Es überleben mehr Schnecken mit einem hellen Haus, weil es weniger Hitze absorbiert.«Menno Schilthuizen
Zu der Farbe hat Schilthuizen eine Hypothese entwickelt. Er vermutet, dass die Schnirkelschnecke in der Stadt eine hellere Behausung trägt als in ländlichen Regionen, weil es in Städten heißer ist. »Die Gebäude und Straßen in der Stadt absorbieren die Hitze der Sonne, auch Menschen und Maschinen steuern Wärme bei.« Das führe dazu, dass die Durchschnittstemperatur in mittleren Städten zwei bis drei Grad höher liegt als im Umland. In Megacitys wie New York oder Tokio kann der Temperaturunterschied mehr als zehn Grad betragen. Schnirkelschnecken mögen Hitze und Trockenheit nicht besonders, sie verharren dann wochenlang in einer Art Starre. »Kommen dann noch ein paar Grad Hitze hinzu, kann es für sie tödlich werden. Also überleben mehr Schnecken mit einem hellen Haus, weil es weniger Hitze absorbiert.«
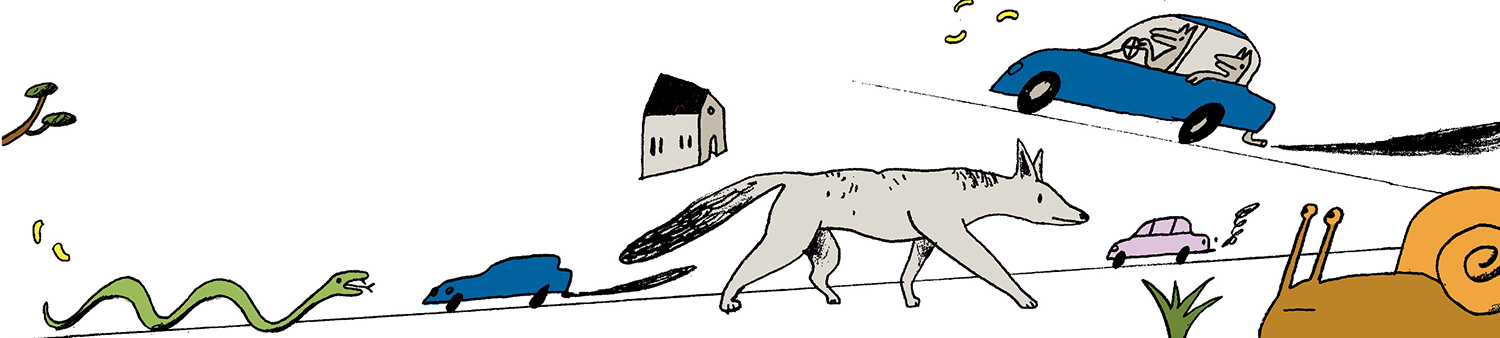
Während sich die Schnirkelschnecke an Wärme anpassen muss, profitieren Halsbandsittiche. Es ist kein Zufall, dass sie zwar selbst im Norden Europas, jedoch nur in den Städten auftauchen – in den Wärmeinseln. Dass die Stadt außerdem ein All-Inclusive-Catering aus Essensresten und Meisenknödeln bietet, führte zu einer regelrechten Explosion der Sittichpopulationen in Paris und London – wo man inzwischen erwägt, sie wie Schädlinge zu behandeln.
Im Grunde ist Schilthuizen innerhalb seiner Profession ebenso ein Exot wie der grüne Sittich in Paris. Schon als junger Biologe hegte er eine heimliche Liebe zur Urbanität. »Wenn ich ehrlich sein soll«, sagt er, »mag ich besonders die schmuddeligen Ecken. Dort begegnen sich das Natürliche und das Artifizielle und gehen ökologische Beziehungen miteinander ein.« Gewöhnlich betrachtet die Biologenzunft Städte als notwendiges Übel, in denen man so wenig Zeit wie möglich verbringt. Es gilt als Ideal, Darwins Spuren zu folgen und in der Wildnis zu forschen. In Gebirgen, in Wald und Feld; »eben da, wo die wilden Kerle wohnen«, sagt Schilthuizen und rollt mit den Augen. Ein Grünstreifen neben der Straße galt noch vor einigen Jahren als quasi tot. »Für mein persönliches Biologen-Auge ist die Stadt dagegen ein herrliches Arrangement aus Mini-Ökosystemen.«
Waggonweise Pendlerblut – der ideale Ort für Mücken
Was für fantastische Ökosysteme die schmuddeligen Winkel zu bieten haben, zeigt Culex pipiens molestus. Die Londoner U-Bahn-Mücke ist ein Beispiel für eine ganz neue Art, die es ausschließlich in Städten gibt. Das lästige Insekt – so die Übersetzung von molestus – hat sich nach Eröffnung der London Underground im Jahr 1863 offenbar zügig entwickelt. Es unterscheidet sich genetisch deutlich von seinen oberirdischen Verwandten, Culex pipiens. So deutlich, dass sich zwei jeweilige Exemplare nicht mehr miteinander fortpflanzen können – in der Biologie der klassische Beweis, dass eine neue Art entstanden ist. Die oberirdischen Verwandten leben von Vogelblut und halten Winterschlaf. Die Bahnmücke ist zu jeder Jahreszeit putzmunter und wird in den Tunneln waggonweise mit frischem Pendlerblut versorgt; für ein Mittagessen muss sie nicht viel herumfliegen. Darum entwickeln sich sogar die Mücken der einzelnen Linien unabhängig voneinander. Schilthuizen erklärt: »Da sie ja ihre Tunnel nie verlassen, müssten sie am Oxford Circus umsteigen, um sich mit den Bewohnern anderer Linien zu paaren.« So unterscheiden sich die Tiere der Bakerloo- und der Victoria-Linie deutlich in ihrem Erbgut. Insgesamt drei verschiedene U-Bahn-Mückenarten haben sich bereits gebildet.

Die Stadt als Lebensraum bringt aber auch Gemeinsamkeiten. »In Zukunft werden sich die Ökosysteme der Großstädte auf unterschiedlichen Erdteilen einander mehr ähneln als jenen in den umliegenden ländlichen Regionen.« Tatsächlich gibt es die U-Bahn-Mücke nicht mehr nur in London. Immer wieder scheinen Exemplare doch aus ihren Tunneln heraus und in Automobile oder Flugzeuge zu geraten. Die Mücke findet sich mittlerweile in großstädtischen U-Bahnen, Kellerräumen und Zisternen überall auf der Welt.
Ist das schon Evolution?
Aber, da all das ein sehr junges Geschehen ist – kann das Evolution sein? Dass Tiere und Pflanzen sich genetisch und in ihrem Verhalten an ihren Lebensraum anpassen, ist das Wesen der Evolution. Charles Darwin war überzeugt, dass dafür Äonen verstreichen müssen: »Wir sehen nichts von diesen langsam fortschreitenden Veränderungen, bis die Hand der Zeit auf eine abgelaufene Weltperiode hindeutet, und dann […] nehmen wir nur noch das Eine wahr – dass die Lebensformen jetzt verschieden von dem sind, was sie früher gewesen sind«, schrieb er in der Entstehung der Arten. Seit einigen Jahrzehnten mehren sich aber die Hinweise, dass sich Insekten, Pflanzen, Vögel und sogar Säugetiere wie Mäuse weitaus zügiger verändern, nämlich in weniger als zwei Generationen. Städte scheinen einen Turboeffekt auszulösen: Vor drei Jahren werteten eine Forscher:innen der Universität Washington mehr als 1.600 Einzelstudien aus. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Verstädterung der Umwelt die Geschwindigkeit der Evolution erhöht, gemessen an den Veränderungen des Aussehens innerhalb der Arten – in manchen Fällen sogar verdoppelt.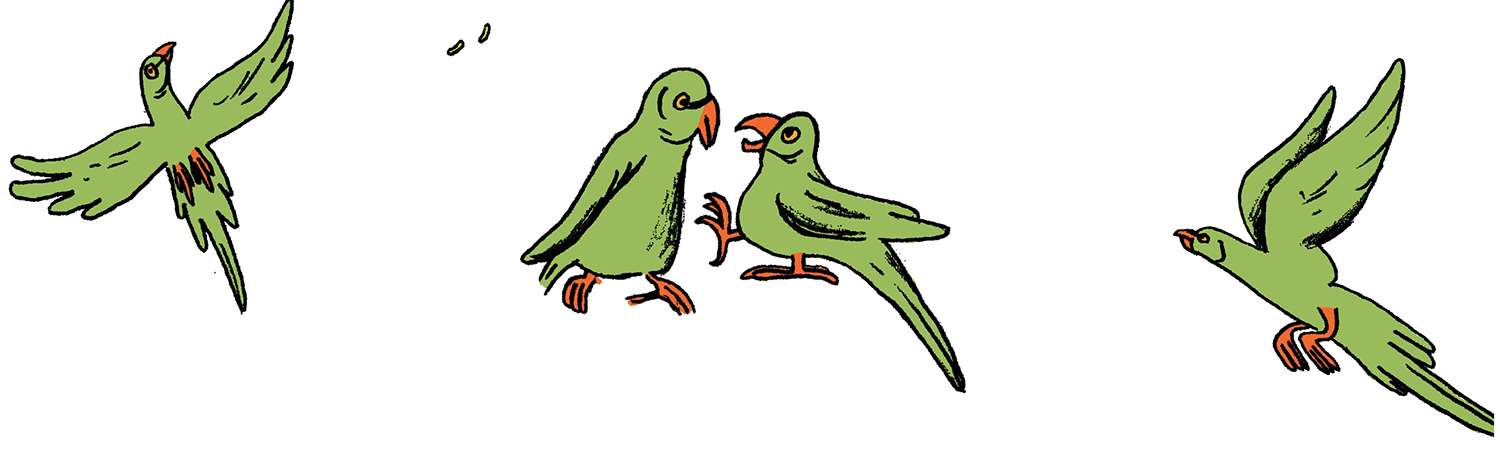 »Städte sind ein extremer Lebensraum«, sagt Schilthuizen. Dass die Evolution hier rast, liegt an dem enormen Selektionsdruck, den das Leben darin verursacht. Faktoren wie Lärm, Verkehr und Verschmutzung kommen zur Hitze der Stadt hinzu. Auch an neue biologische Gegebenheiten muss sich das urbane Leben anpassen: Menschen schaffen sich gerne exotische Pflanzen und Haustiere an, bringen Samen und Larven aus fremden Ländern mit. Wer sich in dieser wilden Gemengelage nicht anpasst, stirbt schnell aus. Schilthuizen vergleicht die Stadt gerne mit einem Schnellkochtopf – Evolution unter Hochdruck.
»Städte sind ein extremer Lebensraum«, sagt Schilthuizen. Dass die Evolution hier rast, liegt an dem enormen Selektionsdruck, den das Leben darin verursacht. Faktoren wie Lärm, Verkehr und Verschmutzung kommen zur Hitze der Stadt hinzu. Auch an neue biologische Gegebenheiten muss sich das urbane Leben anpassen: Menschen schaffen sich gerne exotische Pflanzen und Haustiere an, bringen Samen und Larven aus fremden Ländern mit. Wer sich in dieser wilden Gemengelage nicht anpasst, stirbt schnell aus. Schilthuizen vergleicht die Stadt gerne mit einem Schnellkochtopf – Evolution unter Hochdruck.
»Ich denke, dass Darwin teilweise falsch lag. Evolution ist eine unglaublich starke Kraft – er hat sie unterschätzt.«
Menno Schilthuizen
Bleibt noch eine Frage hinsichtlich eines ganz bestimmten Tiers: Neue Lebensräume, neue Verhaltensweisen, neue Vorlieben bei der Partnerwahl – gibt es womöglich in der Zukunft nicht nur urbane Tierarten, sondern auch den Stadt-Menschen? »Dafür gibt es tatsächlich Hinweise«, sagt Schilthuizen. »Das sollten Wissenschaftler mal genauer untersuchen.« Überraschen würde es ihn kein bisschen.
Erschienen am 01. April 2021