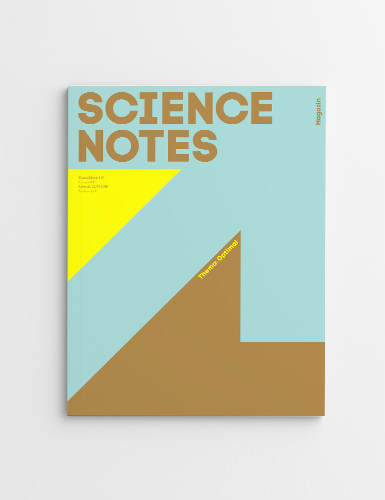Wie werden 2050 neun Milliarden Menschen satt? Indem man Abwasser aus der Fischzucht als Dünger für Gemüsebeete nutzt. Ein Besuch beim Aquaponik-Forscher Werner Kloas.
Die feuchte Luft klebt auf der Haut, es riecht leicht modrig in dem Gewächshaus am Berliner Müggelsee, knapp 26 Grad Celsius Innentemperatur zeigt das Thermometer. Pumpen brummen, Wasser plätschert und in großen schwarzen Plastikfässern tummeln sich goldrote Fischschwärme: Tilapien, aus der Familie der Buntbarsche, zapplige Dinger, die jedem, der zu nahe an ihre Becken tritt, eine Dusche verpassen. Neben den Fässern wachsen prächtige Tomatenstauden in die Höhe, sie wurzeln in Röhren ohne Erde.

Daneben steht Werner Kloas. Der Zoologe leitet am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) die Abteilung Ökophysiologie und Aquakultur und ist quasi der Chef hier im Tomaten-Barsch-Haus. Mit der kleinen Experimental-Anlage ist er angetreten, große Fragen zu beantworten: Wie lassen sich 2050 mehr als neun Milliarden Menschen ausreichend und zugleich ausgewogen ernähren – und zwar ohne die Raubbaumethoden der industrialisierten Landwirtschaft? Kloas’ Antwort: Mit Hilfe der Aquaponik.
Wie lassen sich 2050 über neun Milliarden Menschen ernähren?
Der Fachbegriff beschreibt die Kombination aus Fischzuchtanlagen in geschlossenem Wasserkreislauf, sogenannten Recirculating Aquaculture Systems (RAS), und dem Gemüseanbau, der ohne Erde auskommt: der Hydroponik. Die Verbindung der beiden Konzepte löst ein Problem der RAS-Anlagen: In diesen Systemen zirkuliert das Wasser aus der Fischhaltung, um zu verhindern, dass Futterreste und Fischexkremente Flüsse, Seen oder Küstenabschnitte belasten. Stattdessen wird das Wasser in einen Kreislauf mit mechanischen sowie biologischen Filtern geführt. Bakterien wandeln dort die toxischen Stickstoffverbindungen Ammonium und Ammoniak aus den Fischausscheidungen zu Nitrit und schließlich Nitrat um. Allerdings beeinträchtigt auch Nitrat ab einer bestimmten Konzentration das Wohl der Fische.

Aquaponik setzt genau hier an: Was die Fische im Wasser hinterlassen, wird zwar auch im bakteriellen Biofilter aufgearbeitet; dann aber leiten die Tomatenfischer das Abwasser in eine Gemüsekultur – als Dünger. Die Pflanzenwurzeln nehmen Nitrat und andere Nährstoffe auf, und das gereinigte Wasser fließt in die Fischtanks zurück. Der Kreislauf ist geschlossen. Das Resultat ist eine künstliche Quasi-Symbiose: aus einer schmutzigen Brühe wird eine wertvolle Ressource. Die Aquaponik spart Wasser und Dünger – beides Rohstoffe, die immer wertvoller werden.
Schon die alten Chinesen machten sich die Vorteile solcher kombinierter Fisch-Gemüsezuchten in Ansätzen zunutze, indem sie Schmerlen und Karpfen in ihren Reisfeldern hielten. Die Aquaponik-Systeme der Neuzeit gehen sogar noch einige Schritte weiter: So wandert in geschlossenen Gewächshäusern das von den Fischen ausgeatmete CO² nicht in die Atmosphäre, sondern klimafreundlich ebenfalls direkt ins Gemüse. Außerdem sind Pestizide und Antibiotika gegen Schädlinge und Infektionen wegen der Vergiftungsgefahr für Fische und Pflanzen ein „No-Go“, stattdessen kommen desinfizierendes UV-Licht oder Nützlinge wie Schlupfwespen zum Einsatz. Und schließlich ist das Verfahren nicht auf Meer, Flüsse oder Seen angewiesen, sondern funktioniert standortunabhängig – was wiederum eine lokale Produktion ohne lange Transportwege und Lagerketten ermöglicht.
Knackpunkt für die Effizienz: der pH-Wert
Warum also stehen Aquaponik-Anlagen nicht schon längst an allen Ecken? Weil sie aus Sicht der IGB-Forscher um Werner Kloas bislang einen entscheidenden Haken hatten: So liegt der optimale pH-Wert für Fische, aber auch für die Bakterienstämme im Biofilter in der Regel zwischen leicht alkalischen 7 und 9. Die meisten Pflanzen dagegen nehmen Nährstoffe am besten bei einem moderat sauren Wert von 6 bis 6,5 auf. Die bislang kursierenden Anlagendesigns versuchten daher meist, einen Wert in der Mitte zu wählen – mit dem Risiko erhöhter Stresslevel bei den Fischen sowie ungünstigem Gemüsewachstum. „Eine effiziente Produktion ist auf diese Weise nicht möglich“, sagt Kloas.

Der Forscher und sein Team griffen daher eine Bastelei ihres Kollegen Bernhard Rennert auf. Schon in den 1980er-Jahren hatte der Biologe am Ostberliner Institut für Binnenfischerei eine Karpfen – mit einer Gurkenzucht kombiniert – und das pH-Problem folgendermaßen gelöst: Das Fischwasser ließ er in einen separaten Tank mit einem schlichten Einwegventil ablaufen. So konnte er das Wasser nicht nur nach Bedarf zu den Gurken leiten und, wenn nötig, Zusatzdünger beimischen, sondern auch den pH-Wert in beiden Kulturen getrennt einstellen. Als Rennert 2007 während einer Teamsitzung von seinen Experimenten erzählte, sei das „ein Aha-Erlebnis“ gewesen, erinnert sich Kloas. Der Zoologe dachte Rennerts Ansatz noch weiter: Wenn er die Verdunstungsfeuchte der Pflanzen über Kühlfallen auffangen und wieder zurück in die Fischzucht speisen könnte, ließe sich auch in dem entkoppelten System ein Wasserkreislauf etablieren.
Die Idee für das Tomaten-Barsch-Haus war geboren. Ab März 2009 produzierte die vom Bundesforschungsministerium geförderte Anlage innerhalb von neun Monaten auf knapp 170 Quadratmetern etwa 600 Kilogramm Tilapien und rund eine Tonne Gemüse. Wäre zwischendurch nicht der Strom für die Pumpen ausgefallen, ärgert sich Werner Kloas bis heute, die Ernte wäre noch deutlich besser gewesen. Die Pilotanlage machte unter dem Namen „Tomatenfisch“ trotzdem Karriere und gewann 2012 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis – weil das Projekt „neue Perspektiven für die Nahrungsmittelproduktion entwickelt“ habe, so die Jury.

Gleichwohl bleiben noch etliche wissenschaftliche Fragen rund um die Aquaponik zu beantworten. Welche Fisch-Pflanzen-Kombinationen harmonieren am besten? Und wie können die Tiere nachhaltig gefüttert werden? Zwar sind Fische aufgrund ihres geringen Energiebedarfs im Vergleich zu anderen Nutztieren exzellente Futterverwerter: Aus einem Kilo Trockenfutter können nach einer groben Daumenregel rund ein Kilo Fisch erzeugt werden. Aber bislang enthalten konventionelle Futterpellets Fischmehl und -öl, wofür auch gezielt Sardellen oder Sandaale aus den Meeren gefangen werden. Das ist schon jetzt keine ökologisch sinnvolle Lösung. Vor dem Hintergrund der weltweit wachsenden Zuchtfisch-Nachfrage müssen daher dringend Alternativen gefunden werden.
Insektenmehl wäre ein ideales Fischfutter
Die im Süßwasser lebenden Buntbarsche sind in dieser Hinsicht eine ziemlich gute Wahl. Anders als räuberische Salzwasser-Spezies wie Lachs, Wolfsbarsch oder Heilbutt, die hohe Proteinanteile von bis zu 80 Prozent im Futter benötigen, kommen die allesfressenden Tilapien mit nur 32 Prozent aus. Dennoch sollten auch ihre Proteinquellen möglichst nachhaltig sein. Als besonders vielversprechend haben sich die Maden der Soldatenfliege erwiesen: Auf Lebensmittelabfällen gezüchtet, anschließend getrocknet und zu Mehl verarbeitet, könnten sie ein ideales Fischfutter abgeben. Bislang allerdings ist das eiweißreiche Fliegenmadenmehl in der EU für Nutztiere nicht zugelassen. Und überhaupt muss die Aquaponik-Community ganz Grundsätzliches klären, bevor an einen Massenmarkt zu denken ist: „Uns fehlen noch richtige Definitionen und Klassifikationen“, bemängelt etwa die Biologin Ranka Junge von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Ist es beispielsweise schon Aquaponik, wenn jemand ein Kräuterbeet auf seinem Aquarium zieht? Welche Ziele sollen und können mit dem Verfahren überhaupt erreicht werden? Die Selbstversorgung auf Ebene einzelner Haushalte, wie sie etwa die Welternährungsorganisation FAO bereits im Gaza-Streifen erprobte? Oder doch die Produktion für größere Absatzmärkte? Und welche rechtlichen Grundlagen soll es hierfür geben?
Manfred Klinkhardt beobachtet die Aquakulturbranche schon seit Jahrzehnten. Bei der Aquaponik ist der Fischereibiologe und Fachpublizist jedoch skeptisch. „Kreislaufanlagen“, sagt er, „habe ich kommen und gehen sehen, alle mit großen Versprechungen.“ Der Grundgedanke der Aquaponik sei zwar simpel – die Ausführung aber viel zu verspielt und komplex. Bau und Betrieb einer Anlage würden dadurch enorm teuer. Zudem spielten Tilapien und Co. auf dem europäischen Markt derzeit so gut wie keine Rolle. „Letztlich ist Aquakultur aber nichts Altruistisches, sondern ein Wirtschaftsunternehmen, das sich rechnen muss.“ Klinkhardt traut der Aquaponik daher vorerst keine größere Praxisrelevanz zu, „das wird auf absehbare Zeit ein Tummelplatz der Forschung bleiben.“ Zumal es in hiesigen Breiten schon genug Tomaten und Salat gebe. „Warum also soll sich ein Fischwirt neben seinem ohnehin schon schwierigen Geschäft auch noch mit der Gemüsezucht herumschlagen?“
Letztlich ist Aquakultur nichts Altruistisches, sondern ein Wirtschaftsunternehmen, das sich rechnen muss
Einige Unternehmen setzen dennoch auf die Aquaponik. FarmedHere aus Chicago oder die australischen Tailor Made Fish Farms beispielsweise sind seit Jahren am Markt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten testet ein Firmenverbund aus Öl- und Luftfahrtindustrie, ob sich mit Aquaponik Biokraftstoffe herstellen lassen. In Europa wiederum zählen die Urban Farmers aus Zürich zu den Pionieren. Fisch und Gemüse von ihrer Dachfarm verkaufen sie an lokale Restaurants und den Einzelhandel. Nach eigenen Angaben schreibt der laufende Betrieb eine schwarze Null, das Kundenfeedback sei sehr positiv.

In Berlin steht seit Ende 2014 ebenfalls eine 2000 Quadratmeter große Aquaponikanlage, betrieben von ECF Farmsystems. Das Start-up zieht hier Basilikum und Tilapien, zur Kundschaft zählen Restaurants und Einzelhändler, darunter REWE, in deren Filialen das Kilo Buntbarsch für knapp 13 Euro zu haben ist. „Zielgruppe unserer Produkte“, sagt ECF-Chef Nicolas Leschke, „sind ernährungsbewusste Städter, die gesunde und qualitativ hochwertige Lebensmittel schätzen.“ Das eigentliche Geschäft machen Leschke und die Konkurrenz aber damit, Anlagen zu konzipieren und zu bauen. Einem Schweizer Obst- und Gemüsehändler hat das Start-up bereits eine Anlage aufs Dach gestellt, weitere Projekte sind in Arbeit.
Finanzstarke Bio-Fans oder Durchschnittsbürger – wer ist die Zielgruppe?
Liegt also hier die Zukunft der Aquaponik? In einem Nischenmarkt für gut verdienende, ernährungsbewusste Großstädter? Immerhin: Einer Studie des Marktforschungsinstituts IndustryARC zufolge wird diese Nische im Jahr 2021 schon knapp 1 Milliarde US-Dollar umsetzen.
Werner Kloas reicht das nicht. Die bestehenden gewerblichen Anlagen produzierten im Verhältnis zu den Personalkosten zu wenig und seien eher „Modegag“ oder „Eventgeschichte“, sagt der Forscher. „Wenn man mit Aquaponik aber die gesamte Nahrungsmittelproduktion verändern will, muss man auf Masse gehen.“ Er plädiert daher für hektargroße Riesenfarmen, in denen mindestens drei bis vier Mal mehr Gemüse als Fisch wächst. „Sonst werden die Nährstoffe im Wasser nicht verbraucht und müssen weggeschüttet werden. Das ist aber nicht Sinn der Sache.“
Wenn man die Nahrungsmittelproduktion verändern will, muss man auf Masse gehen
Um zu zeigen, dass Aquaponik im industriellen Maßstab funktionieren kann, haben sich Werner Kloas und sein Team vom IGB mit 17 Partnern aus acht Ländern zusammengetan: In dem mit sechs Millionen Euro von der EU geförderten Projekt INAPRO sind vier Demonstrationsanlagen in Deutschland, Belgien, Spanien und China angedacht, um das System unter verschiedenen geografischen und klimatischen Bedingungen zu erproben. Sensoren überwachen die Wasserqualität und Nährstoffgehalte, Steuerungssysteme passen die Parameter automatisch an, beheizt werden die Becken mit ungenutzter Abwärme von Biogasanlagen. Die jeweiligen Betreiber, allesamt aus der Aquakultur-Branche, testen die Anlagen zudem auf ihre Praktikabilität und – ganz wichtig – auf Rentabilität.
Die auf 500 Quadratmetern in Waren an der Müritz aufgebaute deutsche Testanlage steht bereits seit Sommer 2016 und hat die ersten Tomaten- und Fischernten verkauft. Auch im spanischen Murcia soll es trotz einiger Verzögerungen bald soweit sein. Außerdem arbeitet das Team an einem Modellierungstool, das Anlagen in beliebiger Größe und je nach Geografie und gewünschten Fisch- und Gemüsearten skalieren und durchrechnen kann.

Denn genau darum geht es Werner Kloas: Die Aquaponik weltweit voranzutreiben. Neben der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen von INAPRO kooperiert das IGB daher auch mit der ägyptischen al-Azhar-Universität, um die Technik in einem Schwellenland zu erproben – schließlich haben gerade schwächer entwickelte Nationen häufig mit Wassermangel und Nahrungsmittelknappheit zu kämpfen. Zwar seien in diesen Fällen auch kleine, dezentrale Subsistenz-Anlagen denkbar, etwa für Familien oder Dorfgemeinschaften, so Kloas. Trotzdem müsse es dort ebenfalls eine größere Produktion geben, am besten im städtischen Raum. „Denn Urbanisierung und Bevölkerungswachstum, die finden vor allem in den nicht-industrialisierten Regionen der Welt statt.“
Der Wissenschaftler ist überzeugt, dass INAPRO eine Initialzündung für die kommerzielle Aquaponik sein kann. „Sobald sich zeigt, dass sich diese Anlagen ökonomisch tragen, wird die Privatwirtschaft immer mehr investieren.“ Von heute auf morgen gehe das natürlich nicht – aber im Jahr 2050, so Kloas, werde es zumindest in Mitteleuropa kaum noch Gewächshäuser ohne Aquakultur geben.
01. Februar 2018