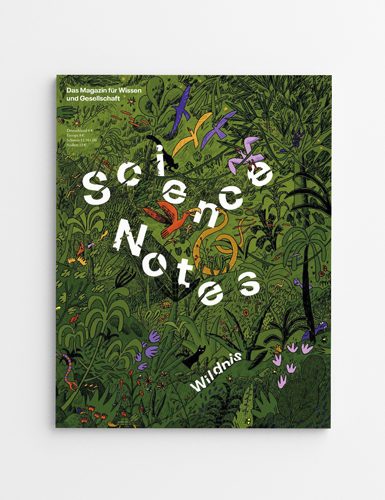Ein Essay von Svenja Beller
In rauen Zacken bricht der Fels in die Tiefe ab, auf den Ebenen von unberührtem Schnee bedeckt. Majestätisch sind die Bergmassive, die sich vor unseren Augen auftürmen. Die Sonne taucht die Gipfel in warmes Licht, aus dem Tal kriecht der Nebel empor – es ist diese perfekte Magie der wilden Berge, die der schweizerische Künstler Julian Charrière mit seiner Fotoserie »Panorama« eingefangen hat.
 »Um Mittag, wenn
»Um Mittag, wenn
der junge Sommer ins Gebirge steigt,
da spricht er auch
doch sehen wir sein Sprechen nur:
sein Atem quillt wie eines Wandersmanns
im Winterfrost«
Friedrich Nietzsche schrieb diese Zeilen einst über das Hochgebirge der Schweiz. Er wird dabei eine Landschaft wie diese vor Augen gehabt haben.
Jedes seiner Bilder hat Charrière mit den GPS-Daten des Aufnahmeorts versehen. Doch gebe ich etwa 52° 29′ 51.18″ N 13° 22′ 17.40″ E in ein Navigationssystem ein, lande ich nicht in den Alpen, sondern am Gleisdreieck in Berlin. Der Fehler liegt nicht etwa in der Verortung, sondern in den Bildern selbst – oder vielmehr in unserer Lesart. Denn was Julian Charrière fotografierte, waren keine Berge, sondern Erdhaufen auf einer Berliner Baustelle. Mit Mehl, Feuerlöschschaum, Nebel und Licht schuf er die perfekte Illusion eines Bergpanoramas. Er konstruierte Wildnis, wo keine war.
Damit visualisierte er etwas, was wir alle tun, ohne uns dessen bewusst zu sein: Wir konstruieren Wildnis. Denn der Begriff ist nicht trennscharf, vom Duden etwa wird Wildnis vage als »unwegsames, nicht bebautes, besiedeltes Gebiet« umrissen. Demnach könnte sie in der Arktis zu finden sein, oder auch in der brach liegenden Parzelle eines Neubaugebiets. Wo – und vor allem was – ist sie also wirklich? Dem deutschen Naturphilosophen Thomas Kirchhoff zufolge lässt sich Wildnis am besten greifen, indem man ausschließt, was sie nicht ist: »Eine Wildnis ist eine Gegend immer dann, wenn wir ihr – bewusst oder unbewusst – die symbolische Bedeutung einer Gegenwelt zur kulturellen beziehungsweise zivilisatorischen Ordnung zuweisen und dabei ihre Unbeherrschtheit betonen«, definiert er. Sie sei eine moralische Gegenwelt, ein Antiuniversum. Ob wir die Wildnis dabei positiv oder negativ bewerten, hängt davon ab, ob wir die damit kontrastierende Ordnung gut oder schlecht finden.
 Freiheit, Abenteuer – oder Bedrohung?
Freiheit, Abenteuer – oder Bedrohung?
Manche können in ihr also im Kontrast zur kontrollierten Gesellschaft einen Ort der Freiheit und Abenteuer sehen, andere würden sie als Bedrohung einer mühsam geschaffenen Ordnung wahrnehmen, wieder andere könnten in ihr die letzten heilen Überbleibsel der Welt wähnen, wie sie war, bevor der Mensch sich auf ihr ausbreitete wie ein Schimmelpilz. Nichts davon ist richtig und nichts falsch. Für mich selbst war Wildnis bis jetzt ein idealisierter Sehnsuchtsort, an den es mich zog, wenn mir die Zivilisation zu eng wurde. Aber ich ahne, dass ich es mir mit dieser Vorstellung zu leicht gemacht habe.
Thomas Kirchhoff ist einer von vielen Wissenschaftlern weltweit, die das Phänomen Wildnis entschlüsseln – und entzaubern. Einer der prominentesten unter ihnen ist der US-amerikanische Umwelthistoriker William Cronon. Mit seinem Essay Das Problem mit der Wildnis, oder: Rückkehr zur falschen Natur provozierte er vor 25 Jahren derart, dass er sich ein Jahr später dazu genötigt sah, eine Entschuldigung zu veröffentlichen. Denn er hatte den Menschen ihre Wildnis genommen, indem er etwa schrieb:
»Wir stellen uns allzu leicht vor, dass das, was wir sehen, Natur ist, wenn wir in Wirklichkeit das Spiegelbild unserer eigenen Sehnsüchte und Wünsche sehen.«
Dieses Spiegelbild ist immer ein anderes – je nachdem, wer in den Spiegel schaut. Wo und wann wir leben, hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir Wildnis sehen. Grob lässt sich sagen: Je ausgelieferter der Mensch der Wildnis und ihren Gefahren ist, desto ambivalenter ist auch seine Beziehung zu ihr. »Heutzutage hat Wildnis vor allem positive Bedeutungen, die sukzessive seit Beginn der Neuzeit entstanden sind«, stellt Thomas Kirchhoff fest. Reisen wir in die Vergangenheit, in eine Zeit vor Autos, GPS-Geräten und Funktionskleidung, dann ist die Wildnis alles andere als ein schöner Sehnsuchtsort: Bis vor wenigen hundert Jahren beschrieben Menschen die Wildnis fast ausschließlich negativ, etwa als verwaist, grausam, primitiv, trostlos, nutzlos oder unbrauchbar. Die Bibel lehrte: Wildnis ist der Ort des moralisch Bösen, die Menschen fürchteten sich vor ihr und konnten sie nur mit viel Kraft zähmen und für sich nutzbar machen. In ihrem ursprünglichen Zustand hielt die Wildnis für die Menschheit so gut wie nichts bereit. Das sollte sich erst in der Frühen Neuzeit ändern, als sich auch die Weltsicht der Menschen wandelte: Sie übertrugen die Unendlichkeit Gottes auf die materielle Welt, die sie bis dahin für endlich gehalten hatten. Wildnis wurde zum Ort perfekter göttlicher Ordnung, oder wie William Cronon schreibt: »Satans Zuhause war zu Gottes eigenem Tempel geworden.«
Reisen wir in die Vergangenheit, in eine Zeit vor Autos, GPS-Geräten und Funktionskleidung, dann ist die Wildnis alles andere als ein schöner Sehnsuchtsort: Bis vor wenigen hundert Jahren beschrieben Menschen die Wildnis fast ausschließlich negativ, etwa als verwaist, grausam, primitiv, trostlos, nutzlos oder unbrauchbar. Die Bibel lehrte: Wildnis ist der Ort des moralisch Bösen, die Menschen fürchteten sich vor ihr und konnten sie nur mit viel Kraft zähmen und für sich nutzbar machen. In ihrem ursprünglichen Zustand hielt die Wildnis für die Menschheit so gut wie nichts bereit. Das sollte sich erst in der Frühen Neuzeit ändern, als sich auch die Weltsicht der Menschen wandelte: Sie übertrugen die Unendlichkeit Gottes auf die materielle Welt, die sie bis dahin für endlich gehalten hatten. Wildnis wurde zum Ort perfekter göttlicher Ordnung, oder wie William Cronon schreibt: »Satans Zuhause war zu Gottes eigenem Tempel geworden.«
Mit der bald folgenden Aufklärung machten sich die Philosophen an die Umdeutung der Wildnis, und kamen dabei zu Recht unterschiedlichen Ansichten: Für Immanuel Kant etwa symbolisierte sie die Triebnatur des Menschen, die ihn unfrei mache, denn nur wer der Vernunft folge, handle wirklich frei. Jean-Jacques Rousseau hingegen galt der einsame Aufenthalt in der Wildnis als erstrebenswert – allerdings war das für ihn nur der bestmögliche Ersatz für das Leben in einer tugendhaften, naturnahen Gemeinschaft, für die er aber damals – und das würde wohl auch heute noch gelten – keinen Raum sah.

Spiegel der Abgründe der eigenen Seele
Von den Aufklärern jeder Übernatürlichkeit der Natur beraubt, sehnten sich die Romantiker dann wieder nach einer höheren Bedeutung. Die ambivalenten Gefühle, die den Betrachter beim Anblick von Bergspitzen, Schluchten oder Wasserfällen befallen können, sahen sie als »Ausdruck der dunklen (›okkulten‹), sich der Vernunft entziehenden Seite der Natur, als Spiegel der Abgründe der eigenen Seele«, schreibt Thomas Kirchhoff. Zentral für diese Empfindung ist die Erhabenheit der Natur, die auch schon Generationen vor ihnen spürten. Diese Gegenwart des Erhabenen beschreiben etwa der britische Dichter William Wordsworth und der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau jedoch nicht als angenehm, sondern als angsteinflößend. »Ich habe diese Erde nie und nimmer geschaffen für deine Füße, diese Luft ist nicht für deine Lungen, diese Felsen sollen dir keine Nachbarn sein«, lässt Thoreau die Natur in seinem Bericht Ktaadn zu dem Wanderer im Gebirge sprechen. Auch der irisch-britische Schriftsteller Edmund Burke spürte diese Angst. Er empfand sie aber als »delightful horror«, der die Nerven stärke und den Körper fit halte.
Heute ist diese Angst im dicht besiedelten und hoch entwickelten Europa beinahe verschwunden. Menschen wie ich sehnen sich nach der Wildnis, nach der Gegenwelt zu unserer Kultur. Eine Umfrage in meinem Freundeskreis bestätigt das: Für meine Freunde ist Wildnis gute Luft, Stille, Selbstvergessenheit, Menschenleere, Zeitlosigkeit und kein Handyempfang. Sie ist alles, was ihr großstädtisches Umfeld nicht ist. Würden meine Freunde in den USA leben, wäre vielleicht auch »Nostalgie« unter den Antworten gewesen, denn für Amerikaner ist Wildnis oft ein Phänomen aus der Zeit der Siedler, die aus der wilden Natur heroisch den amerikanischen Staat herausschnitzten. »Frontier« nannten sie diese Wildnis, die zum Verschwinden verdammt war, je weiter sich die Siedler ausbreiteten. Erstreckte sich der »Wilde Westen« einst fast bis zur Ostküste, wurde er um 1890 für vollständig besiedelt erklärt. »Die Frontier ist verschwunden«, schrieb damals der Historiker Frederick Jackson Turner, »und mit ihrem Verschwinden hat sich die erste Periode der amerikanischen Geschichte geschlossen.« Es ist wohl auch der Angst vor dem Verlust einer nationalen Identität geschuldet, dass es die USA waren, die mit Yellowstone 1872 den ersten Nationalpark der Welt einrichteten. War die Wildnis einst das große Weite außerhalb der Mauern und Zäune, so wurde sie nun das Kleine innerhalb der Zäune, mit der großen Zivilisation drumherum.
Unberührt – aber von wem?
Allerdings war das, was sich die Amerikaner da so schön als »unberührte« Natur eingezäunt haben, keineswegs unberührt. Auf diesem Land lebten indigene Völker, die gewaltsam vertrieben und in Reservate gesperrt wurden. »Der Mythos der Wildnis als jungfräuliches, unbewohntes Land war schon immer besonders grausam, wenn man ihn aus der Perspektive der Indianer betrachtet, die dieses Land einst ihr Zuhause genannt haben«, schreibt William Cronon dazu. Das gilt natürlich nicht nur für die USA, sondern ist weltweit ein Problem. Cronon findet die Bezeichnung »Wildnis« deswegen nicht nur scheinheilig, er sieht in ihr auch eine Flucht vor der Geschichte in einen vermeintlich zeitlosen Raum: »Ganz gleich, aus welchem Blickwinkel wir sie betrachten, die Wildnis bietet uns die Illusion, dass wir den Sorgen und Nöten der Welt entfliehen können, in die uns unsere Vergangenheit verstrickt hat.«

Wie ein Gebiet genau beschaffen sein muss, damit wir es Wildnis nennen, darüber herrscht damals wie heute keine Einigkeit. Laut dem UNEP Weltüberwachungszentrum für Naturschutz ist Wildnis »ein großes Gebiet mit unverändertem oder geringfügig verändertem Land und/oder Meer, das seinen natürlichen Charakter und Einfluss beibehält, ohne dauerhafte oder signifikante Besiedlung«. Die Weltnaturschutzunion definiert ebenfalls vage »eine ausreichende Größe« etwa für biologische Vielfalt, Ökosystemleistungen und evolutionäre Prozesse. Zu finden ist eine derart definierte Wildnis grob gesagt da, wo Menschen schwer hinkommen: Im kalten Norden, in hohen Bergregionen, in Wüsten oder tiefen Wäldern. Laut einer vor zwei Jahren im Fachmagazin Nature veröffentlichten Analyse sind nur noch 23 Prozent der globalen Landfläche (ausgenommen die Antarktis) und 13 Prozent des Ozeans frei von direktem menschlichen Einfluss, also laut ihrer Interpretation »Wildnis«. Um sie zu kartieren, verwendeten die Forscher Indikatoren wie bebaute Gebiete, Ackerflächen, Weideland, Bevölkerungsdichte, nächtliche Beleuchtung, Eisenbahnen, Hauptstraßen und schiffbare Wasserwege. Erst wenn eine Fläche von mindestens 10.000 Quadratkilometern frei von solchen Einflüssen war, wurde sie gezählt.
Zerstören wir die Wildnis, wenn wir sie finden?
Stünde also eine kleine Hütte mit einem Zufahrtsweg in so einer Wildnis, wäre sie dann gleich keine Wildnis mehr? Und hieße das auch, dass wir unseren Sehnsuchtsort Wildnis zerstören, indem wir ihn finden und dort unsere Spuren hinterlassen? Zählte man übrigens wirklich jede Spur der Menschheit mit – wie Mikroplastik oder das durch uns veränderte Klima – dann bliebe wohl gar keine Wildnis mehr übrig. Längst rufen Forscher weltweit das Zeitalter des Anthropozäns aus, weil der Mensch den Planeten allerorten irreversibel verändert habe. »Unberührte« Natur ist in diesem Zeitalter mehr denn je eine Illusion. Denkt man das konsequent zu Ende, dann könnte Wildnis eigentlich nur außerhalb unserer Wahrnehmung existieren, denn selbst die Radiosignale unserer weltumspannenden Satellitensysteme sind als menschlicher Einfluss auf die Natur zu werten.

Aber warum muss Natur unberührt sein, damit wir sie als Wildnis und damit als erhaltenswert anerkennen? Oder anders gefragt: Warum darf jedes andere Lebewesen sie berühren, nur wir nicht? Mir erscheint es furchtbar traurig, dass wir uns so vehement aus dem Rest allen Lebens auf Erden ausklammern. Dass wir in der von uns so hoch idealisierten Wildnis laut unserer eigenen Definition niemals einen Platz haben werden. William Cronon sieht darin sogar eine große Gefahr, denn wenn wir uns jeden Ort in der Natur versagen, wie sollen wir dann jemals ein nachhaltiges Leben gemeinsam mit Pflanzen und Tieren finden? Und dass wir das dringend finden müssen, lehren uns die Zeichen der Zeit – das Schmelzen der Gletscher, das extremere Wetter, das Verschwinden von Arten. Kann es wirklich unser Ideal sein, die Wildnis fernab von uns unter eine (sehr kleine) Schutzhaube zu stellen, während wir die Natur drumherum unbekümmert ausbeuten? Und wenn wir diesen Gedanken weiterführen, ist es dann nicht sogar schädlich, den Begriff Wildnis weiter zu verwenden?
»Mir erscheint es furchtbar traurig, dass wir in der Wildnis keinen Platz haben sollen.«
Ich finde: nein. Wenn die Bezeichnung uns dabei hilft, Ehrfurcht, Bescheidenheit und Staunen gegenüber der Natur zu empfinden, dann erfüllt sie eine wichtige Funktion. Wir täten allerdings besser daran, uns aus der Wildnis nicht länger auszuklammern. Warum sollte sie nicht auch im nächstgelegenen Gebüsch zu finden sein, statt nur in der erhabenen Weite? Der Baum im Garten, der nahe gelegene Teich, die brach liegende Parzelle im Neubaugebiet – das alles kann Wildnis sein, wenn wir es zulassen. Es ist Zeit, uns in der Wildnis und die Wildnis um uns anzuerkennen.
Erschienen am 01. April 2021