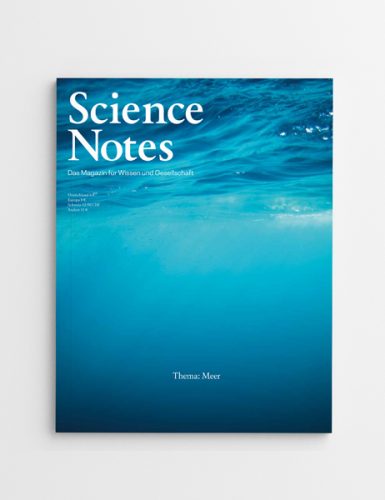Wie New Yorker U-Bahn-Wagen zu einem Zuhause für Fische wurden
Vor 20 Jahren steht die Metropolitan Transportation Authority (MTA) in New York City vor einem Problem: Sie will Hunderte alte U-Bahn-Waggons ausmustern, aber die Entsorgungskosten haben sich gerade vervielfacht. Nicht nur lohnt sich das Recycling nicht, weil die alten U-Bahn-Wagen aus wenig attraktivem Karbonstahl sind. Arbeiter haben beim Abwracken der ersten Waggons auch noch eine Schicht gefunden, die Asbest enthält. Das krebserregende Material fachgerecht herauslösen und entsorgen zu müssen, das dürfte Mike Zacchea schlaflose Nächte gekostet haben. Bei der MTA ist Zacchea zuständig für die Entsorgung der Redbirds, wie New Yorker die weinroten Waggons liebevoll nennen.
Da erzählt Zaccheas Bruder, Kapitän eines Charterboots, dass einige US-Bundesstaaten künstliche Riffe vor ihren Küsten bauen. Dazu versenken sie Schrott im Atlantik: Panzer, Betonklötze, Schiffswracks. Warum nicht auch die Redbirds? Mike Zacchea zögert nicht. Im September 2000 überzeugt er die Fischereibehörde in New Yorks Nachbarstaat New Jersey, ihm 650 Waggons abzunehmen. Als bekannt wird, dass Asbest in den Waggons steckt, macht New Jersey einen Rückzieher.
»Das Asbest stellt kein Problem dar«
Etwas weiter südlich, im kleinen Bundesstaat Delaware, hat man weniger Bedenken. Hier ist es Jeff Tinsmans Job, künstliche Riffe zu bauen. Der Meeresbiologe will ein Paradies für Fische, Muscheln und Polypen schaffen. Die U-Bahn-Wagen nimmt Tinsmann gerne, weil es nicht einfach ist, kostengünstig an geeignetes Material zu kommen. »Das Asbest stellt kein Problem dar«, erklärt er. »Das ist nur in den Lungen von Säugetieren ein Problem.« Dort können die Fasern nicht vollständig abgebaut werden und beginnen, das Gewebe zu schädigen. Auch Fische können nachweislich von Asbest geschädigt werden. Aber erst bei Konzentrationen von Hunderten Millionen Fasern pro Liter. Bei den U-Bahnen werden pro Liter rund 100 Fasern erwartet.
Im November 2003 fährt ein Lastkahn die Redbirds vor die Küste Delawares. Ein Bagger stößt sie ins Wasser, und seither rosten sie dort langsam vor sich hin.
Die Transitbehörde MTA hat so geschätzte 17 Millionen Dollar Entsorgungskosten gespart. Den Meeresbewohnern allerdings konnten die 1.329 U-Bahn-Waggons keine dauerhafte Heimat bieten. Die Redbirds hätten sich schon nahezu vollständig zersetzt, berichteten Taucher bereits im Jahr 2016. Zuletzt versenkte Delaware daher Schiffswracks, die das Redbird-Riff lebendig halten sollen.
Jeff Tinsman fährt regelmäßig hinaus zu den künstlichen Riffen. Er sucht dann vor allem nach jungen Fischen, um zu zeigen, dass die Strukturen ihnen Schutz bieten und so dem Aufbau der Fischpopulation dienen. Aber das ist schwer zu beweisen. Ältere Tiere jedenfalls, etwa Flundern und Zackenbarsche, kommen gerne, weil sie hier viel Nahrung finden. Und das wiederum zieht eine andere Spezies an: Menschen. Tinsmans Behörde hat hochgerechnet, dass etwa 17.000 Angler pro Jahr ihr Glück am Redbird-Riff versuchen.
Erschienen am 28. Mai 2020