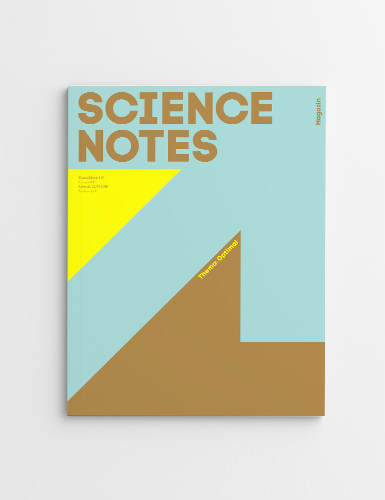Der Klimawandel schafft für einige exotische Pflanzen optimale Bedingungen – und lässt manch braves Gartenblümchen invasiv werden. Welche Arten sind riskant?

Man sieht ihr die schlechten Manieren nicht an. Schlank und hochgewachsen steht sie im Botanischen Garten der Uni Konstanz, den gelben Schopf zur Sonne gereckt. Mit ihrer Anmut hatte sich die Kanadische Goldrute schon im siebzehnten Jahrhundert aus ihrer nordamerikanischen Heimat in die Herzen europäischer Blumenfreunde geschlichen – und mit der Zeit auch über deren Gartenzäune hinweg, an Straßenrändern und Bahnstrecken entlang, später hinaus in die freie Wildbahn. Dort wächst Solidago canadensis nun in großen Populationen, sehr zum Ärger von Umweltschützern und Nationalpark-Rangern – sie können die pflanzlichen Eindringlinge aus fernen Kontinenten überhaupt nicht leiden. Die Goldrute gilt als invasiver Neophyt, als eingeführte Pflanze also, die sich ordentlich breit macht in der neuen Heimat. Das Klima hierzulande taugt ihr gut, ihre natürlichen Fraßfeinde hat sie auf der Reise über den Atlantik abgeschüttelt und heimischen Insekten macht sie wenig Appetit. So konnte sie hier Wurzeln schlagen, kann sich ungestört vermehren, ganze Gebiete überwuchern und heimische Pflanzen verdrängen. Ganz bewusst haben wir uns diese Problemblume auf den Kontinent geholt, als grünen Zierrat und exotischen Farbtupfer – genau wie tausende andere Arten auch.
Mark van Kleunen allerdings würdigt die üppig blühende Pflanze kaum eines Blickes; die Goldrute ist für ihn ein alter Hut. Der Konstanzer Evolutionsbiologe und Vegetationsökologe schaut eher in die Zukunft: Welche Zierpflanzen wachsen hier in Parks und Gärten friedlich vor sich hin und warten nur auf eine Gelegenheit, um sich in die Wildnis davonzumachen? Welche Arten also bergen invasives Potential – auch angesichts des Klimawandels, der uns immer wärmeres Wetter beschert? Kurzum, wer startet die nächste grüne Invasion? Um diese Fragen zu klären, hat van Kleunen von der Universität Konstanz aus im Rahmen des EU-Forschungsnetzwerkes Biodiversa ein internationales Projekt aufgezogen; außer am Bodensee forschen Wissenschaftler in Tübingen, Wien und Grenoble an potentiellen Invasoren. Prägnanter Titel: „WhoIsNext“. Die Idee kam van Kleunen beim Betrachten eines Fotos von der Mainau, der „Blumeninsel im Bodensee“. Er entdeckte auf dem Bild eine alte Bekannte aus seiner Zeit in Südafrika: Ageratum houstonianum, das Gewöhnliche Leberbalsam. Hier eine hübsche blaue Blume, in der afrikanischen Steppe ein lästiger Neophyt. „Wenn die Art dort unten invasiv ist“, dachte sich der Ökologe, „könnte sie nicht auch hier zum Problem werden?“
Immer schneller, immer weiter reisen fremde Pflanzenarten
Eingeschleppte Pflanzen sind kein neues Phänomen. Seit der Mensch auf Reisen geht, hat er sie als blinde Passagiere oder ganz bewusst im Gepäck. In vielen Blumengärten wachsen heute größtenteils Exoten – die uns schon so vertraut sind, dass wir sie mit deutschen Namen kennen und oft für heimische Gewächse halten: Studentenblume, Mädchenauge, Sonnenblume. Mit schnelleren Transportmitteln, mit steigenden Kapazitäten, mit wachsendem Welthandel – seit 1960 sind die weltweiten Warenexporte um rund das 18-Fache gestiegen – verbreiten sich die neuen Arten jedoch immer weiter um den Globus, in Bananenkisten etwa, zwischen Baumwollbündeln oder gut verpackt in Samentütchen. Einen großen Zensus der eingebürgerten Pflanzenarten veröffentlichte Mark van Kleunen gemeinsam mit einer ganzen Mannschaft internationaler Kollegen 2015 im Fachmagazin Nature: In der GLONAF-Datenbank (Global Naturalized Alien Floras) hatten sie Informationen über jene Pflanzenarten zusammengetragen, die sich bereits irgendwo auf der Welt in einem fremden Habitat etabliert haben. Über 13 000 Spezies bezifferten die Wissenschaftler – das sind über drei Prozent der gesamten globalen Flora. Zum Vergleich: Ursprünglich in Europa heimisch sind nur 14 000 Pflanzenarten.

Im Lauf der Jahre scheint sich der Pflanzenökologe Mark van Kleunen selbst so ungefähr auf Pflanzentempo eingependelt zu haben. In Flipflops und beiger Leinenhose schlendert er durch den Botanischen Garten, braungebrannt von der Forschung im Freien, einen dunklen Fünftagebart und lustige Lachfältchen im Gesicht. Kein schlechter Arbeitsplatz ist das hier, idyllisch gelegen am Waldrand. Es duftet nach Kiefernnadeln und Sommer, es blüht und grünt und in der schattigen Gartenlaube fehlt nur noch eine Hängematte zum perfekten Glück. Der Biologe zeigt auf verschiedene Zierpflanzen, die in Töpfen und Beeten wachsen: Die pink beblätterte Bougainville etwa stammt ursprünglich aus Südamerika, heute verschönert sie Hausfassaden im ganzen Mittelmeerraum. Auch sie wächst in Südafrika inzwischen wild. Oder die Hanfpalme, die eigentlich in Südostasien zuhause ist. Dank der milder werdenden Winter breitet sich das Ziergewächs im Unterholz des Tessins aus. Und zwischen den Ritzen der Bodenplatten hat sich ein Mohnpflänzchen emporgezwängt, mit seinen knallorangenen Blüten ist Eschscholzia californica ein wahrer Blickfang. „Die Pflanze hat sich wohl aus einem unserer Beete ausgewildert“, überlegt van Kleunen. „Schön ist sie ja schon.“ Aber auch ein echter Problemfall: In Australien, Südafrika und Europa hat sich der Kalifornische Mohn schon verbreitet; in Deutschland wurde das sogenannte Schlafmützchen sogar ausgezeichnet – als Giftpflanze des Jahres 2016. „Die Pflanzen sind alle schon da“, sagt van Kleunen. „Die müssen nur noch über den Zaun springen.“
Zwar werden die wenigsten der Neuankömmlinge zum Problemfall. Nur zehn Prozent der fremden Arten, die in natürliche Gebiete gelangen, können sich überhaupt auf Dauer dort halten; und nur jede hundertste dieser etablierten Arten wiederum übt einen signifikanten Einfluss auf die betroffenen Lebensgemeinschaften aus. Doch wie beträchtlich der sein kann, das hat Mark van Kleunen in Südafrika erlebt. Nach dem Biologie-Studium im niederländischen Utrecht, der Promotion als Evolutionsbiologe in Zürich und einer Postdoc-Stelle in Kanada war er an der University of KwaZulu-Natal gelandet, an der Ostküste des Landes. Bei Ausflügen in die nahe gelegenen Drakensberge stieß er immer wieder auf ganze Felder voller Cosmea, einer bunt leuchtenden Schönheit aus der Familie der Korbblütler. Eigentlich stammt die Pflanze aus Mittelamerika. Auch dem Gewöhnlichen Leberbalsam, jenem blau blühenden Einwanderer aus Mexiko, begegnete van Kleunen immer wieder im Süden Afrikas. Wirklich verheerende Auswirkungen pflanzlicher Invasion lernte der Ökologe im Westen des Landes kennen, in der sensiblen Fynbos-Vegetation rund um Kapstadt. Die wird unter anderem von einer Australierin bedroht: Die immerdurstige Schwarzholz-Akazie gräbt mit ihren tiefen Wurzeln der einheimischen Vegetation das Wasser ab, verdrängt die angestammten Arten und bedroht so die Diversität dieses besonders artenreichen Ökosystems. „Wie sich solche Multikulti-Vegetationen auf Ökosysteme als Ganzes auswirken, darüber wissen wir noch viel zu wenig“, sagt Mark van Kleunen. „Aber eine hohe Biodiversität ist sehr wichtig. Die Systeme sind dann zum Beispiel produktiver und stabiler bei Trockenheit.“
Zwei Drittel aller Zierblumenarten sind Exoten
Auch in Europa gibt es eine ganze Menge Kandidaten, um die 14 000 heimischen Wildpflanzenarten aufzumischen: Hier werden rund 22 000 Zierpflanzenarten gehandelt, fast 15 000 davon stammen aus der Ferne. Um deren jeweiliges Risikopotential zu berechnen, haben sich van Kleunen und seine Kollegen erst einmal durch Berge von Daten und Fachliteratur gekämpft. Die fünfbändige „European Garden Flora“ lieferte ihnen genaue Charakterisierungen aller hier genutzten Zierpflanzen: Unter welchen Bedingungen keimen die Samen? Wie schnell wachsen die Pflanzen? Sind sie fähig zur Selbstbestäubung und zur vegetativen Vermehrung über Ableger und Ausläufer? Auch betrachteten die Wissenschaftler verschiedene mögliche Klimaszenarien – welche Arten würden von welchen Bedingungen profitieren? Dann analysierten sie die Statistiken des europäischen Blumenhandels um herauszufinden, welche Blumen in den verschiedenen Regionen angeboten werden und um regionale Vorlieben der Gärtner ausfindig zu machen. Denn je mehr Gärten eine Art als Ausgangspunkt hat, desto größer sind die Möglichkeiten für eine erfolgreiche Auswilderung. Zuletzt ließen die Ökologen in ihre große Gleichung noch die pflanzlichen „Vorstrafenregister“ einfließen: die Informationen aus der GLONAF-Datenbank. Denn wer einmal unangenehm auffällt, der tut es mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder – möglicherweise auch in einem anderen Ökosystem, auf einem anderen Kontinent.

Aus diesem riesigen Datenberg destillierten die Ökologen 37 Arten, deren Charakteristika ein aufdringliches Wesen vermuten ließen – allesamt Gewächse, die in heimischen Gärten gepflanzt, aber bisher nicht in europäischer Wildbahn etabliert sind. Für die Kontrollgruppen wählten sie außerdem 14 heimische und 13 fremde, schon etablierte Arten aus. Alle Versuchsarten pflanzten sie auf genau abgesteckte Rasenparzellen in eine typisch deutsche Wiese. Jeden Samen hatten die Biologen abgezählt. Die Hälfte der Parzellen wurde zudem beheizt – zur Simulation der Temperaturen im Laufe des Klimawandels. Wie unterscheiden sich die exotischen Pflanzen von den heimischen? Wer steckt den simulierten Klimawandel gleichgültig weg, wer ist gestresst – und welche Arten profitieren gar von der Hitze?
Simulierter Klimawandel

Zeitweise hätten sie die beheizte Simulationsanlage in Konstanz gar nicht gebraucht – die Durchschnittstemperaturen der Jahre 2014 und 2015 haben auch so schon alle Rekorde geknackt. Dennoch leuchteten die Infrarotlampen im Botanischen Garten rund um die Uhr. Die abgesteckten Wiesenstücke darunter heizten sie konstant zwei Grad wärmer als die Parzellen nebenan, Infrarotkameras überwachten die Rasentemperatur. Zudem experimentierten die Kollegen in Tübingen auf ihren Versuchsflächen mit künstlich veränderten Niederschlägen. Was in den Experimenten über zwei Jahre hinweg auf je zwei mal zwei Metern geschah, könnte demnächst Standard sein auf heimischen Wiesen – laut der Klimamodelle für Baden-Württemberg liegt eine Steigerung der Durchschnittstemperatur um bis zu 1,7 Grad Celsius bis zum Jahr 2050 durchaus im Bereich des Möglichen, im restlichen Deutschland sieht es ähnlich aus. Zudem verschieben sich die Niederschläge: Insgesamt wird es feuchter. Vor allem die Winterniederschläge nehmen deutlich zu, die Sommer dagegen werden tendenziell trockener. Das kommt zwar den meisten Pflanzenarten – auch den meisten Exoten – nicht unbedingt entgegen. Für einige Spezies jedoch könnten sich mit den veränderten Bedingungen ganz neue Chancen auftun.
Die Versuchsergebnisse – Keimungserfolg etwa, Überlebensraten oder die Biomasseproduktion der jeweiligen Arten – lieferten die Praktiker aus Konstanz und Tübingen wiederum laufend an die Computerspezialisten in Grenoble und Wien, für weitere Modellrechnungen. „Es gibt ein ständiges Feedback zwischen Modellen und Versuchen“, erklärt van Kleunen. „Die Modelle warten auf die Daten, die wir hier im Garten generieren.“ Die Wissenschaftler justieren so ihre Algorithmen – um noch viele weitere Arten auf ihr Potential als Invasoren hin abklopfen zu können.
Heimische Alternativen in Parks und Gärten
In einem ungewöhnlichen Projekt hat Katharina Mayer die bisherigen Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt. Die Pflanzenökologin arbeitet im Team von Mark van Kleunen an der Uni Konstanz. In Kooperation mit der Deutschen Umwelthilfe hat sie die Parks, Friedhöfe und Stadtgärten in Radolfzell am Bodensee unter die Lupe genommen und die öffentlich finanzierte Blütenpracht auf ihre Herkunft hin analysiert. Zusätzlich klingelte sie bei vielen Radolfzellern an der Haustür – um zu fragen, ob sie die Pflanzenarten in den Gärten notieren dürfe. „Die Besitzer waren dann meistens ein bisschen stolz auf ihre Gärten und haben mich zum Kaffee eingeladen“, erzählt Mayer. Wenn die Ökologin die problematischen Arten im Blumenbeet angesprochen hat, seien die Hobbygärtner allerdings nicht ganz so glücklich gewesen. Ihre in Radolfzell gesammelten Werte glich sie mit den Verbreitungsmodellen für jede gebietsfremde Art ab, mit den GLONAF-Daten und den lokalen Klimaprognosen: Von knapp 1300 Pflanzenarten, die Mayer insgesamt in Radolfzeller Gärten fand, stammten fast 1000 aus der Ferne; zwei Drittel von diesen wiederum tauchen schon in der GLONAF-Datenbank auf, haben also bereits andernorts eine Einbürgerungsgeschichte. Mit Hilfe ihrer Ergebnisse verfasste Katharina Mayer eine Warnliste mit zehn Pflanzenarten, die in Radolfzell in Zukunft besser nicht angepflanzt werden sollten – und empfahl gute Alternativen aus der hiesigen Flora: Statt der aus Mexiko stammenden Cosmea könnten heimische Malven, anstelle des giftigen amerikanischen Wandelröschens doch besser Tannen- oder Essigrosen gepflanzt werden, als Ersatz für den chinesischen Seidenbaum könnten Eberesche oder Elsbeere in den Vorgärten wuchern. Die Kanadische Goldrute jedenfalls, einstiger Liebling der Gärtner, wird zumindest in öffentlichen Anlagen kaum mehr angepflanzt. Ihr Ruf ist ruiniert. Man trifft sie heute an den staubigeren Ecken der Stadt.
Erschienen am 18. März 2018