 Du weißt, du wirst sterben. Und du hoffst, der Tag, an dem es passiert, liegt mindestens so weit entfernt wie das Eintreffen von außerirdischen Zivilisationen. Du vermeidest Gedanken an den Tod. Betrittst du Krankenhäuser, dann hinterlässt das ein Gefühl in dir, das du zwischen Grauen und Ekel verortest, aber nicht genaue beschreiben kannst. Altenheime meidest du.
Du weißt, du wirst sterben. Und du hoffst, der Tag, an dem es passiert, liegt mindestens so weit entfernt wie das Eintreffen von außerirdischen Zivilisationen. Du vermeidest Gedanken an den Tod. Betrittst du Krankenhäuser, dann hinterlässt das ein Gefühl in dir, das du zwischen Grauen und Ekel verortest, aber nicht genaue beschreiben kannst. Altenheime meidest du.
Und nun sitzt du hier vor diesem Text und wirst – wenn du weiterliest – an sechs Orten dem Tod begegnen. Drei Menschen nehmen dich mit auf eine Reise: Lara Maree hat keine Angst vor dem Tod, sie ist vielmehr fasziniert von ihm – das beweist allein ein Blick auf ihr Instagramprofil. @lost.lara führt dich zu Skeletten und Schädeln. Peter Hohenhaus hat im vergangenen Jahr einen Atlas of Dark Destinations veröffentlicht – er bringt dich an Stätten, die aufwühlen und die vielleicht deine Sichtweise verändern werden. Und Tony Walter ist Soziologe – sein Spezialgebiet ist der Tod. Er nimmt dich mit an Orte, die »das kollektive Narrativ einer Nation herausfordern«.
Zwei weitere Personen und ihr Werk schleichen sich immer wieder in den Text: Richard Sharpley und Philip Stone. Die beiden arbeiten an der University of Central Lancashire, Sharpley als Professor für Tourismus und Entwicklung, Stone als Gründer und Geschäftsführer des Institute for Dark Tourism Research. Die beiden haben ein Buch herausgegeben: The Darker Side of Travel.
All diese Menschen bringen dich einem Phänomen näher, das die Sex Pistols Ende der 70er-Jahre als »billigen Urlaub im Elend der anderen« besangen und das seither nicht nur wegen seines Schlagzeilen-versprechenden Namens an Bekanntheit gewann: Dark Tourism (DT). Dieser Ausdruck verbindet zwei Begriffe, die scheinbar wenig miteinander zu tun haben – Tod und Tourismus. Er beschreibt touristische Reisen an Orte, die mit dem Leiden oder Sterben von anderen zu tun haben: Menschen reisen zu Gedenkstätten, auf Schlachtfelder, zu Gräbern von berühmten Personen.
Und zwar ganz schön viele: Eine Atomkatastrophe lockt pro Jahr eine Menge Menschen an, die jede Menge Geld dalassen; die Ukraine verdankt 93 Millionen Euro allein den Tschernobyl-Touristen im Jahr 2019. Das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau besuchten 2017 mehr als zwei Millionen Menschen. Am Kolosseum brutzelten Touristen in den vergangenen Jahren immer mindestens eine Stunde lang in der römischen Sonne, bevor sie auch nur in die Nähe des Tors kamen, das in das Reich der Gladiatoren führt.
Diese Menschen hinterlassen viele Fragen, die die Forschung noch nicht beantworten kann. Eine davon nennt Philip Stone: Wie fühlen und verhalten sich Menschen an bestimmten Dark-Tourism-Orten? In diesem Text reist du mit ihnen. Du kannst einer Person folgen oder dir einzelne Stationen aussuchen. Wichtig ist nur: Lass die letzte Station nicht aus.

Murambi, Ruanda. Peter Hohenhaus hatte Fotos gesehen, er wusste, was ihn erwarten würde am Murambi Genocide Memorial. Und doch traf ihn, was er sah: »Darauf kann man sich nicht wirklich vorbereiten.«
Dabei hat Peter Hohenhaus bereits mehr als 900 Dark-Tourism-Orten gesehen. Als Kind besuchte er mit seinem Vater verlassene Orte, heute reist er gemeinsam mit seiner Frau Sally zu Holocaust-Gedenkstätten, zu ehemaligen Schlachtfeldern oder Schauplätzen des Kalten Krieges.
2007 begegnete er zum ersten Mal dem Begriff »Dark Tourism« und realisierte, dass viele seiner Reisen in diese Kategorie fallen. Weniger als ein Jahr später begann er, darüber zu schreiben. Auf seiner Webseite dark-tourism.com findet sich zu jeder seiner Reisen ein Eintrag.
Unter dem Punkt Murambi steht, dies sei vermutlich die dunkelste, die schockierendste Stätte, die Touristen besuchen können. Hier sehen sie, was der Völkermord in Ruanda hinterließ: Die Opfer – einst in Massengräbern verscharrt – wurden exhumiert und liegen heute halbverwest auf Holzgestellen in Gebäuden, die einmal eine Schule gewesen sind. Ihre Körper sind mit Kalk konserviert, die Menschen, die ursprünglich dunkle Haut hatten, liegen nun kreideweiß da, erinnert sich Hohenhaus.
Es ist keine 30 Jahre her, dass radikale Angehörige der Bevölkerungsmehrheit der Hutu 800.000 Menschen töteten – vor allem Angehörige der Bevölkerungsminderheit der Tutsi sind unter den Opfern.
Peter Hohenhaus sagt: »Da war dieser eigentümliche Geruch, der in der Luft liegt und sicher mit den konservierten Leichen zusammenhängt. Dann blickt man in Gesichter, die aussehen, als seien sie mitten im Schmerzensschrei erstarrt.« Er erzählt von Händen, die sich an Rosenkränze krallen, von eingeschlagenen Schädeln und winzig kleinen Baby-Leichen. »Und wenn man das erste dieser Gebäude überstanden hat, wird man in das nächste geführt, und daraufhin in noch eines, und noch eines … dabei kann man schon nach dem ersten kaum noch.« Und doch ging er weiter, weil er eine Verpflichtung spürte, allen Opfern Respekt zu zollen.
Die Gedenkstätte, schreibt Hohenhaus, lasse sich mit sonstigen Dark-Tourism-Orten nicht vergleichen – sie sei auch weniger für Touristen gedacht als für die Bevölkerung Ruandas. Der Tod ist aus einem bestimmten Grund ausgestellt: Mehr als die Hälfte der ruandischen Bevölkerung ist zu jung, um sich an den Völkermord 1994 erinnern zu können. Die Gedenkstätte soll es so schwer wie möglich machen, den Völkermord zu leugnen.
✝
Achtung: Nicht alle Reisen an »dunkle« Orte sind auch gleich Dark Tourism. Der Begriff selbst sei wenig hilfreich, schreiben die Forscher Richard Sharpley und Philip Stone: Auf der einen Seite biete er zwar einen Rahmen, um jene Formen des Tourismus zu kategorisieren und zu erforschen, die auf eine Weise mit Tod, Horror, Tragödie, Gräueltaten oder Katastrophen verbunden sind. Andererseits sei der Begriff aber negativ konnotiert. So deute das Wort »dunkel« auf ein schauriges Interesse des Touristen am Makabren hin oder vielleicht auf ein Element der Schadenfreude – und sei im Wesentlichen auch ein Etikett, das Attraktionen, Veranstaltungen und Erlebnissen angeheftet wird. Darum definieren sie: Eine Dark-Tourism-Erfahrung ist nur, wenn der Ort für den Touristen mit dem Tod oder dem Leiden von anderen verbunden ist.
✝
Burgio, Italien. Als Kind hatte Lara Maree gelernt, immer vorbereitet zu sein auf Todesgefahren: Am Strand hielt sie Ausschau nach giftigen Quallen und bevor sie ihre Schuhe anzog, schüttelte sie sie aus, wegen der Spinnen. Sie sah, wie die Erwachsenen den Atem anhielten, wenn sie Friedhöfe betraten, sie sah ihre Angst. Ihr ging es anders, sagt sie in einem Zoom-Gespräch. Sie hatte keine Angst. Sie war fasziniert.
2014 zog Lara Maree von einer Farm in Australien nach London. Es war ihr erstes Mal in Europa und sie hakte Touristenattraktionen ab, besuchte Amsterdam, Paris, Prag. Eigentlich wollte sie nach zwei Jahren zurückkehren in die Heimat. Doch sie blieb. Und machte sich auf die Suche nach Orten, an denen es etwas zu sehen gibt. Katakomben. Teile von Lenin-Statuen. Oder Skelette.
Lara Maree plant ihre Reisen oft jahrelang, auf Google Maps markieren grüne Fähnchen Orte, an die sie gern hinmöchte – manchmal weiß sie gar nicht mehr genau, was sie dort erwarten wird. Sie sagt: »Wenn es dann nur ein schlecht erhaltener Schädel ist – das ist Zeitverschwendung.« Manchmal wünscht sie sich, es gäbe so etwas wie »Skeletonadvisor« – eine Plattform, die sie zu gut erhaltenen alten Skeletten führt.
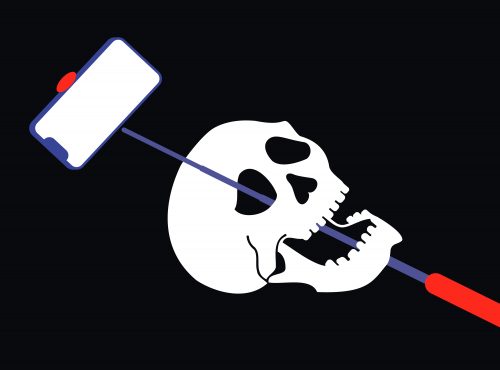
Wer im Internet nach der sizilianischen Stadt Burgio sucht, stößt auf bemalte Terrakotta-Fliesen, Pizzawerbung und Häuser, von denen der Putz bröckelt. Lara Maree stieß hier auf einen Schatz – gäbe es Skeletonadvisor, würde sie dem Ort wohl fünf von fünf Knochen geben. Denn hier gibt es einen kleinen Raum, erzählt Lara Maree, es ist ein friedlicher Raum, in dem mumifizierte Menschen liegen. Stunden verbrachte sie hier – ganz allein mit den Toten. Wären Lebende dagewesen, hätte sie versucht, nicht aufzufallen, dann wäre sie still dagesessen und hätte getan, als spreche sie mit Jesus. Stattdessen hat sie die Skelette fotografiert in ihren verstaubten Kleidern. Ihre Gesichter, deren Kiefer sich zu einem wahnsinnigen Lachen verzogen zu haben schienen.
Als lost.lara postet sie die Fotos auf Instagram. In ihrem Profil reihen sich Selfies mit Lenin neben gestapelte Schädel, Grabsteine und erhängte Puppen. Unter das Foto eines Grabsteins schreibt sie: »Memento Mori. Erinnere dich daran, dass du sterben wirst. Erinnere dich daran, dass du noch am Leben bist.«
Paris, Frankreich. 130 Stufen unter den Straßen von Paris liegt das Reich der Toten. Millionen von Menschen fanden hier ihre letzte Unruhe. Denn zahlreiche Lebende begeben sich hierhin, fotografieren die Wände aus Schädeln und Knochen – und sich selbst davor, wie sie in die Kamera lächeln oder sich eine Taschenlampe unter das Kinn halten, damit sich ihre Gesichter zu unheimlichen Fratzen verziehen; Sie zeigen in den sozialen Netzwerken: Ich war hier.
»Ich hatte nie etwas Ähnliches gesehen«, sagt Lara Maree. 2015 besuchte sie die Katakomben von Paris, heute spricht sie davon wie von einem Erweckungserlebnis: In der Geschichte Europas ist der Tod überall – noch heute blinzelt er aus Grüften und alten Friedhöfen. In Australien hingegen, sagt Lara Maree, gibt es keine Orte wie diese. Der älteste Friedhof, den sie dort besuchte, ist kaum 300 Jahre alt.
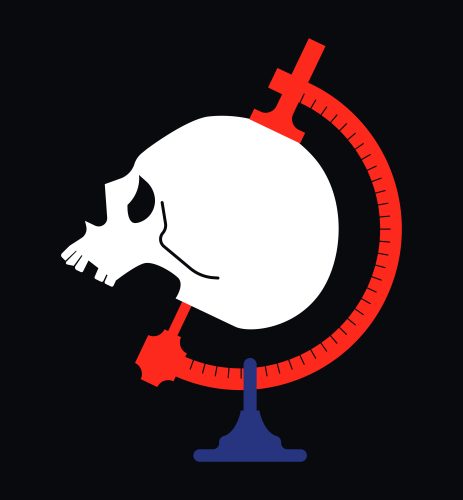
Jahre später postet lost.lara ein Foto der Katakomben auf Instagram – schwarzweiß, nur Knochen und Schädel. Darunter steht: »Wenn ich über das Sterben nachdenke, fühle ich mich klein und ruhig.«
Lara Maree sagt, sie genieße ihr Leben, während sie auf tote Menschen schaut. Auf die Frage, was sie glaubt, was nach ihrem Tod passiert, sagt sie: »Nichts«.
Gut zu wissen: Bereits 1985 füllte der Soziologe Norbert Elias ein ganzes Buch mit Beobachtungen: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen. Er schrieb: »Das Leben wird länger, das Sterben wird weiter hinausgeschoben. Der Anblick von Sterbenden und Toten ist nichts Alltägliches mehr. Man kann im normalen Gang seines Lebens den Tod leichter vergessen.« Nicht nur zeitlich wird der Tod aus dem Leben geschoben, auch räumlich: »Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit wurden Sterbende so hygienisch aus der Sicht der Lebenden fortgeschafft; niemals zuvor wurden menschliche Leichen so geruchlos und mit solcher technischen Perfektion aus dem Sterbezimmer ins Grab expediert.«
In der heutigen Zeit findet der unspektakuläre, der alltägliche Tod vor allem in einer geschlossenen Welt statt: Die Pflege von Kranken und Sterbenden wurde ausgelagert aus dem familiären Umfeld und an externe Institutionen übergeben, so der Soziologe Tony Walter. Der reale Tod passiert in Krankenhäusern und Altenheimen – umgeben von Menschen, die darauf spezialisiert sind, damit umzugehen.
✝
Achtung: Der Tod ist nicht unsichtbar in der heutigen Zeit, schreibt Philip Stone. Er spricht vom Paradox des abwesenden/anwesenden Todes: Der reale Tod ist verschwunden aus dem öffentlichen Blickfeld und wurde ersetzt durch den rekonstruierten Tod des anderen, der durch Medienkanäle in die Welt der Lebenden dringt. Dieser rekonstruierte Tod aber ist kein normaler Tod, er ist außergewöhnlich, spektakulär: Er kommt in Gestalt der Kugel aus der Pistole eines Mafiabosses oder durch den Untergang eines unsinkbaren Schiffes.
✝
New York, USA. Was nicht mehr da ist, hat einen Abdruck hinterlassen. Es hat sich eingebrannt in die Geschichte. Das Bild der Rauchwolke. Das Bild von weißer Asche, die sich über den Boden legt, auf dem die Türme standen. Die Leere, die zurückblieb an diesem Ort, wurde gefüllt – mit dem Geräusch von Wasser, das auf Wasser fällt, mit einem Museum, mit einer neuen Geschichte. Als am 11. September 2001 die Flugzeuge in das Herz von New York City krachen, blieb von der Geschichte des unverwundbaren Amerika nur ein Märchen. »Politiker haben versucht, dieses Narrativ wiederherzustellen – indem sie Krieg im Irak und Afghanistan führen. Und durch Gedenkveranstaltungen am Ground Zero«, sagt Tony Walter.

Tony Walter kennt sich aus mit dem Tod, seit Anfang der 1990er-Jahre versucht der Soziologe, dessen Bedeutung in der modernen Gesellschaft zu verstehen. Seit 2006 arbeitet er als Professor für Death Studies an der University of Bath im Westen Englands, vier Jahre lang leitete er das Centre for Death & Society. Er sagt: Die Toten verfolgen uns, sie bleiben in unseren Leben: durch Fotografien und Filme von Verstorbenen, durch aufgenommene Musik, durch die Worte der Trauernden auf den Pinnwänden der sozialen Medien. Und auch durch die Orte, an denen sie gestorben sind.
Die Massenmedien können zwar den Tod und die Toten zeigen, unwirklich und weit weg. Doch, so Walter, sie können nicht ersetzen, was es heißt, dort zu sein, an den Orten des Todes. Und Philip Stone gibt zu bedenken: An DT-Orten werden Besucher:innen zwar mit dem Tod konfrontiert, doch sie erfahren die Sterblichkeit aus sicherer Entfernung.
In Form von Flugzeugen ist der Tod über unsere Bildschirme gerast. Nun steht ein Mahnmal auf dem Boden, wo einst das World Trade Center war, und allein im Jahr 2018 standen 6,6 Millionen Menschen davor.
Comines-Warneton, Belgien. Steinerne Löwen bewachen die Namen derer, die verschwunden sind. Die gekämpft haben in Schlachten auf dem Gebiet zwischen Normandie und belgischer Grenze, in den Jahren von 1914 bis 1918. Mehr als 11.000 Namen stehen auf weißem Stein in einer Gedenkstätte, die aussieht wie ein meterhohes Kameraobjektiv, das stets auf den Himmel gerichtet ist. Einer davon: Argyle Francis Bradford Walter. Er war Soldat im 13. Bataillon des London Regiments, er starb am 9. Mai 1915. Damals war er 22 Jahre alt.
 Dark Tourism kann die Lebenden und die Toten verbinden, sagt Tony Walter. Dabei komme es auch darauf an, ob und wie sich der Besucher mit den Toten identifiziert oder mit denen, die sie gefoltert und getötet haben. »Der Besuch des Kolosseums in Rom oder die Stätten der Inka-Kinderopfer werden wahrscheinlich eine andere Art von Verbindung zu den Toten schaffen als Besuche von Stätten der Sklaverei im 18. Jahrhundert oder des Völkermords im 20. Jahrhundert.«
Dark Tourism kann die Lebenden und die Toten verbinden, sagt Tony Walter. Dabei komme es auch darauf an, ob und wie sich der Besucher mit den Toten identifiziert oder mit denen, die sie gefoltert und getötet haben. »Der Besuch des Kolosseums in Rom oder die Stätten der Inka-Kinderopfer werden wahrscheinlich eine andere Art von Verbindung zu den Toten schaffen als Besuche von Stätten der Sklaverei im 18. Jahrhundert oder des Völkermords im 20. Jahrhundert.«
Tony Walter sagt: »Würde ich jemals das Ploegsteert Memorial besuchen und den Namen des älteren Bruders meines Vaters eingraviert sehen, das würde mich sicher bewegen.«
✝
Gut zu wissen: Die Toten waren immer die Beschützer der Lebenden – entweder in religiösen Ritualen oder in säkulären Mythen, schreibt Philip Stone. Auch durch Dark Tourism geben wir den Toten eine Zukunft, so wie sie uns eine Vergangenheit geben.
✝
Rouen, Frankreich. Der Tod, der sich an den Dark Destinations zeigt, ist vermutlich nicht dein Tod. Du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bei einer Flugzeugentführung sterben, auch nicht im Gladiatorenkampf, dein Schädel wird nicht von einem Kronleuchter hängen. Tony Walter sagt, er könne nur spekulieren, wie uns der Tod beeinflusst, den wir im Film sehen, in den Zeitungen oder an DT-Orten: »Es scheint, dass das Sehen von einem unrealen oder weit entfernten Tod uns nicht auf die Realität unseres eigenen Todes vorbereitet – nicht so wie es die direkte Erfahrung von sterbenden Familienmitgliedern einst getan hat.«
Deine Reise endet hier, an einem Grabstein auf dem Cimetière Monumental de Rouen. Über dem Namen des Künstlers Marcel Duchamp steht in schwarzen Großbuchstaben auf weißem Granit: »D’ailleurs c’est toujours les autres qui meurent.« Im Übrigen sind es immer die anderen, die sterben.
Erschienen am 24. März 2022
