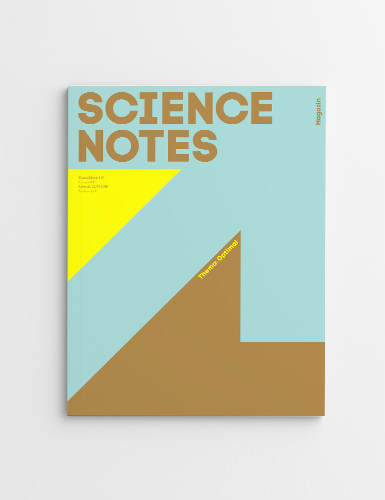Das Streben nach körperlicher und geistiger Verbesserung ist allgegenwärtig.
Wir tun fast alles dafür, ein Idealbild zu erreichen.
Doch geht es uns dabei wirklich um Perfektion? Und wo liegen die Grenzen?
Der (Alp-)Traum vom perfekten Menschen ist in fiktionalen Werken immer wieder aufs Neue ausbuchstabiert worden. In der Moderne verkörpert er sich als Produkt wissenschaftlich-technischer Konstruktion. Man denke nur an Aldous Huxleys Roman „Schöne neue Welt“ oder den Film „Gattaca“ von Andrew Niccol. In beiden Fällen sind es Medizin und Biotechnik, welche die geeigneten Perfektionierungsmittel bereitstellen. Mit den aktuellen Durchbrüchen in den Biowissenschaften scheint der Bau des perfekten Menschen nun in greifbare Nähe gerückt – bleibt bislang jedoch immer noch eine umstrittene Utopie.
Doch geht es uns wirklich darum, perfekt zu werden? Sind wir solche Utopisten?
Doch man muss mitnichten erst in die Zukunft blicken, um ein Streben nach körperlicher und geistiger Verbesserung zu erblicken. Nicht nur im Labor, auch im Alltag sind wir mit allen erdenklichen Mitteln dabei, einem perfekten Idealbild hinterherzujagen. Im Sport. Im Beruf. Im Liebesleben. Selbstoptimierungsarbeit erstreckt sich offenbar auf alle Bereiche des Alltags. Und zum Zwecke der individuellen Verbesserung scheint jedes Mittel recht. Doping. Apps. Meditation. Klappt dieses nicht, klappt vielleicht jenes. Doch geht es uns wirklich darum, perfekt zu werden? Sind wir solche Utopisten?
Perfektion bedeutet Vollkommenheit. Perfektion meint, dass ein Zustand erreicht ist, in dem sich die Teile zu einem Ganzen zusammenfügen, das nicht weiter verbesserbar ist. Um den Zustand der Perfektion zu erreichen, muss man entweder auf überirdische Mächte vertrauen, die einen perfekten Zustand (irgendwann) hervorbringen, oder man muss die Sache – als Mensch, als Gesellschaft – eben selbst in die Hand nehmen und perfektionieren, das heißt: etwas soweit verbessern, bis die angestrebte Vollkommenheit hergestellt ist.
Doch meine ich, dass es heutzutage gar nicht mehr um Perfektion geht. Vom Ideal der Perfektion hat sich unsere Gesellschaft vielmehr grosso modo verabschiedet. Nicht die Verwirklichung einer perfekten Zukunft steht auf der Tagesordnung, sondern etwas anderes: immerwährende Steigerung. Unser Zeitgeist ist jener der Wachstumsorientierung, der Innovation, des Experimentierens mit offenem Ausgang.
Der Unterschied zum Leitbild der Perfektion ist dramatisch. Zum einen wäre der perfekte Mensch irgendwann fertig, das Projekt Selbstoptimierung irgendwann abgeschlossen. Zum anderen wäre einigermaßen klar, wie dieser Endzustand, diese kollektiv verbindliche Utopie eines neuen, perfekten Menschen aussehen könnte.
Wir haben in neoliberalen Zeiten gelernt, dass wir uns fit für eine ungewisse Zukunft machen müssen, dass wir uns dabei nicht auf andere verlassen können, dass wir verantwortlich sind für die Modellierung unserer Existenz.
Die aktuellen Selbstoptimierungspraktiken kommen sehr gut ohne eine solche Utopie aus. Einzelne mögen über eine solche Utopie von einem perfekten Zukunfts-Ich verfügen und könnten dann tatsächlich innehalten, wenn diese realisiert wäre. Paradigmatisch für unsere Zeit ist aber die Optimierung ohne stabile Utopie. Wir ahnen: Die perfekte Zukunft gibt es nicht. Die Welt ändert sich und wir ändern uns in ihr. Auch unsere Ziele und Ideale können sich ändern.
Was aber ist dann der Sinn von Selbstoptimierung? Warum versuchen wir, unsere finanzielle Situation zu verbessern, unser Humankapital zu steigern und unsere Körper zu trainieren? Die typische soziologische Antwort darauf lautet: Weil wir in neoliberalen Zeiten gelernt haben, dass wir uns fit für eine ungewisse Zukunft machen müssen, dass wir uns dabei nicht auf andere verlassen können, dass wir verantwortlich sind für die Modellierung unserer Existenz. In beschleunigten Gesellschaften, in denen in Zukunft nichts sicher sein wird, scheint eine umfassende Verbesserung des Selbst als beste aller Investitionen – als Versicherung gegen Unsicherheit. Was immer auch kommen mag: Ein fitter Körper, ein volles Bankkonto und ein paar Bildungszertifikate mehr können gewiss nicht schaden.
Gewiss keine ganz falsche Deutung – sie hilft uns zumindest, das kontextübergreifende Leitbild der Selbstoptimierung zu verstehen. Auch mag uns die Hoffnung antreiben, dass die unterschiedlichen Kapitalsorten (körperliches Kapital, soziales Kapital, ökonomisches Kapital, …), die wir anhäufen, ineinander übersetzbar sein könnten. Idealerweise zu einem möglichst guten Wechselkurs: Mein gutes Aussehen und meine gesteigerte Selbstsicherheit können mir helfen, Kontakte zu knüpfen, einen besseren Job zu finden und mehr Geld zu verdienen.
Diese Interpretation unserer Selbstoptimierungspraktiken sollte allerdings nicht als biedere Gesellschaftskritik ausgelegt werden, die immer irgendwie passt und die Individuen unserer Gegenwart ganz schön dumm aussehen lässt, fremdgesteuert. Die zeitgenössischen Selbstoptimierer sind enorm kluge und kompetente Leute, die durchaus wissen, was sie tun. Sie handeln innerhalb des Systems, in dem sie sich bewegen, durchaus rational – indem sie sich auf unterschiedlichste Rationalitäten hin optimieren (Gesundheit, Ökonomie, Partnerschaft, …). Ihre Fremdsteuerung ist selbst gewählt.
Doch warum erscheinen die Mittel für Selbstoptimierung so austauschbar? Dies wird verständlich, wenn man ein weiteres
Dispositiv unserer Zeit zur Interpretation hinzuzieht: Das Dispositiv des Technologischen.
Wir können uns entscheiden, welche Mittel wir zur Optimierung verwenden. Tut es der Kaffee am Morgen oder darf es ein wenig pharmazeutisches Doping sein? Oder vielleicht doch lieber ein Blick in eine Ratgeberzeitschrift (oder, zeitgemäßer: ein beratendes YouTube-Video)? Hilft vielleicht eine Yoga-Session zwischendurch oder greift man mutig zu einem hirnstimulierenden Gadget (www.thync.com)?
Interessant ist, dass diese Optionen als Techniken begriffen werden können. Techniken sind Mittel, mit denen Zwecke realisiert werden sollen – idealerweise so, dass sie bei Wiederholung stets den gleichen Effekt hervorbringen. Wird etwas zur Technik, wird es aus seinem (medizinischen, spirituellen, …) Ursprungskontext gelöst und steht zur Verwendung bereit. Das Wissen, das in seine Erschaffung eingeflossen ist, kann uns unbekannt bleiben. Wir müssen nicht wissen, in welchem konkreten kulturellen Kontext die Yoga-Übung entwickelt wurde und welche Theorien sich in ihr verkörpern. Wir müssen nicht wissen, wie das Neurogadget konstruiert wurde und welche wissenschaftlichen Annahmen und Tests seiner Genese zugrunde liegen. Dieses Wissen mag zwar unser Vertrauen in die Technik erhöhen, aber in der Regel genügt uns zum einen der Verweis auf eine Wissensautorität (die fernöstliche Tradition, die moderne Wissenschaft, …), die wir akzeptieren; noch mehr aber verlassen wir uns zum anderen auf die Erfahrung, dass die Technik funktioniert.
Aktuelle Tendenzen der Selbstvermessung basieren hingegen auf der Einsicht, dass wir erschreckend wenig über das Funktionieren von Selbstoptimierungstechniken wissen, dass unsere Erfahrung trügerisch sein kann. Macht uns Kaffee wirklich wacher? Entspannt uns Yoga? Oder bilden wir uns das nur ein? Selbstvermessung eröffnet uns vor diesem Hintergrund eine weitere Ebene des Wissens, eine weitere Technik. Sie erlaubt uns, den eigenen Körper zum Gegenstand von Experimenten zu machen. Selbstvermessung ist Selbstoptimierung zweiter Ordnung: Sie macht wenig reflexive Technikanwender zu reflexiven Technologen. Technologie ist nicht identisch mit Technik. Technologie umfasst auch und gerade die Entwicklung, Untersuchung und Infragestellung von bestehenden Techniken – nicht um der technischen Welt selbst zu entkommen, sondern um neue, vielleicht bessere Techniken in Anschlag zu bringen. Wir prüfen, was funktioniert, bauen Theorien, warum etwas klappt oder einfach nicht klappen will, finden Erklärungen, erproben Alternativen.
Bei all dem bewegen wir uns freilich im Deutungshorizont weiterer Techniken, denen wir vertrauen müssen, wenn wir sie verwenden: den Techniken des Messens und Prüfens eben. Wie jede andere Technik sind auch sie für uns eine Blackbox, ein intransparentes Ding, dessen Erzeugungskontext wir gewöhnlich nicht durschauen – bis wir versuchen, diese Blackbox zu öffnen. Je mehr wir Techniken nicht einfach als Techniken annehmen und hinnehmen, desto mehr werden wir zu reflexiven Wissenssubjekten, bilden selbst einen technikwissenschaftlichen Habitus aus – und nehmen damit zugleich eine weitere soziale Zumutung an, die womöglich ebenso wirkmächtig ist wie jene des Neoliberalismus: die Zumutung der technisierten Informations- und Wissensgesellschaft. Auch hier wird uns der Ball der Verantwortung zugespielt.
Die Befürchtungen der Technokratiekritiker vergangener Jahrzehnte, sie haben sich nicht erfüllt. Wir sind nicht den Deutungen der Experten ausgeliefert, die unser Leben diktieren. Uns wird in der Wissensgesellschaft vielmehr zugemutet, dass wir selbst zu Experten werden, zu kundigen Interpreten unserer technischen Welt und zu kompetenten Navigatoren unseres eigenen Lebens – stets auf der Basis des gegenwärtig verfügbaren Wissens, dass wir uns aneignen sollen, das wir aber zugleich kritisch prüfen und infolgedessen vermehren sollen. Auch dafür stehen uns neue Technologien zur Seite. Jeder Testbericht, den wir schreiben, jeder Stern, den wir vergeben, jedes Like, das wir setzen, bindet uns ein in das Spiel der gesellschaftlichen Wissensproduktion. Wir sind Teil eines neokybernetischen Kreislaufs des Wissens und der Technik, kein geistloses Rädchen im Getriebe, sondern ein beobachtendes Subjekt, dessen Fähigkeit zur Optimierung seiner selbst zur Optimierung des gesellschaftlichen Kreislaufs in Anspruch genommen wird. Neokybernetik heißt: Optimierung durch laufende, reflexive Selbst- und Fremdbeobachtung.
Wir tragen die Verantwortung für unsere eigene Selbstbegrenzung in einer entgrenzten Gesellschaft.
Damit schließt sich der Kreis. Die zeitgenössische Selbstoptimierung – sie ist eine Praxis mit offenem Ausgang, ohne Ideal, ohne kollektiv bindende Utopie. Sie erlaubt uns, auch morgen noch im Spiel zu bleiben und uns im Wettbewerb zu positionieren. Sie erlaubt uns ein flexibles Justieren unseres Ichs angesichts von Ungewissheit. Die Wege zur Selbstoptimierung sind so vielfältig wie austauschbar, sofern wir nur immer neue Objekte und Prozesse als Instrumente begreifen, als Techniken, als Mittel zum Zweck. Die Mittel wandeln sich. Die Zwecke ebenso. Und unser Wissen über die Funktionalität und Effektivität unserer Selbstoptimierungstechniken ist stets unvollständig. Die Gesellschaft gibt uns keine Stoppregeln vor – weder für das Optimieren, noch für das Wissen.
Diese Stoppregeln müssen wir selbst setzen: Heute kein Fitnessstudio mehr, morgen nicht noch einen Onlinekurs. Wir tragen die Verantwortung für unsere eigene Selbstbegrenzung in einer entgrenzten Gesellschaft. Und unsere Akzeptanz dieser Verantwortung für unser Selbst ist ebenfalls ein Aspekt unserer Gegenwartsgesellschaft. Jede Deutung von Selbstoptimierung, die dies verkennt und an die Stelle der Gesellschaft den Narzissmus des Subjekts setzt, verkennt den sozialen Charakter von Selbstoptimierungspraktiken.
Durch unsere Selbstoptimierung setzten wir einerseits Systemimperative um, eignen uns diese (durchaus eigenwillig) an und tragen so zugleich zur Optimierung unseres Gesellschaftssystems bei. Ein perfekter (?) Kreislauf. Das zumindest ist das neokybernetische Narrativ der Gegenwart. Wir sollten es kritisch zu lesen lernen.
Gibt es Strategien, diesen Kreislauf zu irritieren, ohne sich dem Kulturpessimismus hinzugeben? Es scheint allzu naiv, dem allgegenwärtigen Trend zu Entgrenzung, Beschleunigung und Verbesserung schlicht die Romantik einer begrenzten, entschleunigten und mit sich selbst zufriedenen Welt entgegenzuhalten. Vielleicht lohnt daher die Suche nach (oder die Wiederentdeckung von) alternativen Entgrenzungspraktiken, die nicht auf wohldefinierte Zwecke ausgerichtet sind: Das besessene Eintauchen in ein Wissensfeld, dessen gesellschaftliche Nützlichkeit bestritten wird. Die Lust an der Beschleunigung des Körpers im Parkour, die auch den Sturz in Kauf nimmt. Ein entgrenzender Rausch am Abend, der nicht schon mit der Sicherheit des katerlosen Morgens rechnet. Man könnte versuchen, unberechenbar zu bleiben – mit dem Wissen, dass auch die Kultivierung unberechenbarer Subjekte als gesellschaftliche Ressource in Anspruch genommen werden kann.
Erschienen am 18. März 2018