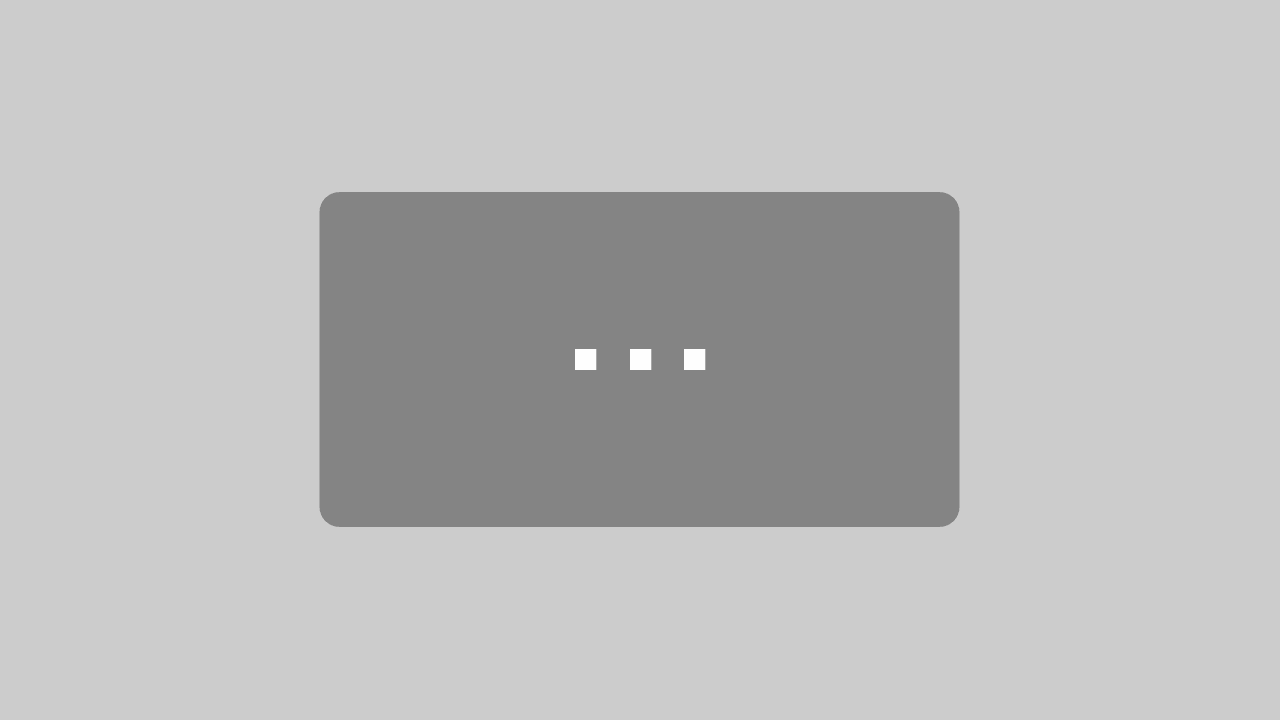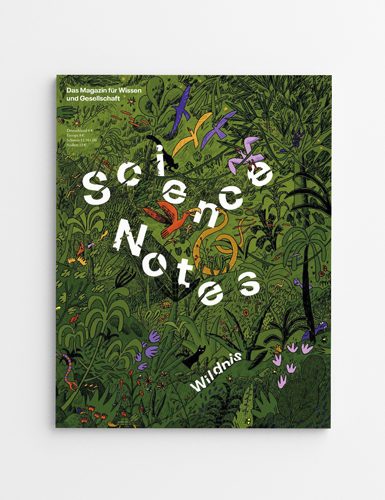Tote Tiere sind ein Fest für die Artenvielfalt. Doch fast alle großen Kadaver werden aus unseren Wäldern entfernt – ein Fehler, findet ein Kadaverökologe. Auf Leichenschau im Bayerischen Wald.

Grelles Licht, etwa 80 Kilometer pro Stunde, da springt ein Schemen aus der Nacht, vielleicht hallt ein Hupen über die Straße und verfängt sich am Waldrand in Zweigen. Ein Rums, ein Scheppern, das Reh blutet noch rot. So fängt es an.
Irgendwo im Wald nehmen Wurzeln Nährstoffe auf, wo der Körper liegen blieb, düngen besonders viel Phosphor, Magnesium, Kalium den Boden. Vielleicht nagt ein Eichhörnchen an einer Rippe, vom Reh bleiben nur Knochen. So hört es auf.
Dazwischen landen Fliegen, schlüpfen Maden, befallen Käfer den Körper. Das Gewusel wächst sich aus zu einem Krieg, die einen setzen auf Anzahl, die anderen auf Strategie. Groß frisst klein, klein frisst noch kleiner, das Reh wird verschlungen von vielen.
Zumindest kommt es so, überlässt man Tierkadaver dem Wirken der Natur. Der Mensch aber will die Wildnis zähmen, auch im Tod braucht alles seine Ordnung: Was stirbt und größer ist als Maus oder Wellensittich, muss weg. Das ist per Gesetz geregelt: durch die EU-Verordnung EG Nr. 1069/2009.
Mehr als 270.000 Wildunfälle im Jahr zählt das statistische Bundesamt. Die Tiere gilt es schnell zu »entsorgen«, wie es in der Verordnung heißt. Wer sich des Kadavers annimmt, muss die Seuchengefahr prüfen. Meistens kümmern sich die Jäger, die das nächste Waldstück gepachtet haben. Sind diese nicht erreichbar oder lehnen ab, müssen Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs ran. Egal ob Jäger oder Leute vom Bauhof: Der Weg der Entsorgung führt meist in die Tierverwertungsanlage. Gemeinsam mit Schlachtabfällen und größeren Haustieren wie Katzen oder Hunden wird der Kadaver zerlegt und entsorgt, oft verbrannt.
»Effizient aufgeräumte Landschaften beeinflussen etwa die Hälfte aller Nahrungsnetze weltweit. Das gefährdet das Ökosystem, denn alles ist mit allem verbunden.«
Seit auf Wiesen weder Schaf noch Ziege liegen bleiben und in den Alpen Helikopter helfen, tote Rinder auszufliegen, sind Aasfresser wie der Gänsegeier in Deutschland weitgehend ausgestorben. Wissenschaftler einer deutsch-amerikanischen Forschergemeinschaft schreiben im April in der Fachzeitschrift Ecosphere: Effizient aufgeräumte Landschaften beeinflussen etwa die Hälfte aller Nahrungsnetze weltweit. Das gefährde das Ökosystem, denn alles sei mit allem verbunden. Entferne man einen einzigen Vektor, egal wie klein, zittere das ganze Gebilde.
Es geht auch anders.
Luderplätze nennen Jäger die Orte im Wald, an denen sie tote Wildtiere der Natur überlassen. Diese Plätze sind selten geworden in Deutschland. Naturschützer kritisieren, das Fehlen von Aas raube einem ganzen Spektrum von Arten die Lebensgrundlage. Im Nationalpark Bayerischer Wald hat ein Forschungsteam deshalb mehrere Dutzend Luderplätze angelegt, um der Frage nachzuspüren: Wie beeinflusst das Vergehen das Leben?
Wird in der Nähe des Bayerischen Waldes ein Reh überfahren, dauert es keine zwei Stunden, dann lagert das Tier in einem Plastiksack. Schnell in die Tiefkühltruhe, minus 20 Grad Celsius, manchmal bleibt es da für Tage, manchmal für Wochen. Dann kommt es raus aus der Truhe, nicht aus dem Sack. Auftauen, zwei Tage lang. Kehrt die Wärme zurück, starten Prozesse im Reh: Enzyme beginnen, Proteine zu verdauen. Weil kein Immunsystem sie hindert, dringen Fäulnisbakterien in den Körper. Von außen wird jedes Tier von einem Ökologen des Nationalparks genau untersucht. Zum Reh notiert er: Zwei offene Wunden, links und rechts des Brustkorbs, gebrochene Rippen. Auffahrunfall vermutlich.
An einem Dienstag geht die Reise weiter. Ein Geländewagen trägt die Leiche über Straßen in den Wald, tiefer hinein wird das 17-Kilo-Reh mit Menschenkraft transportiert, wird der Körper zu schwer, hilft ein Plastikschlitten über die Hügel und Gruben. Zwischen Buchen und Tannen, ein paar Dutzend Schritt entfernt von Straße und Wanderweg, öffnen die Forscher den Sack. Einen Lidschlag später sind sie schon gelandet, die Schmeißfliegen. Hunderte krabbeln den Körper ab, schieben sich zwischen das Fell zur Haut, tasten, drücken, suchen Plätze für ihre Brut.

Die Wissenschaftler durchstechen mit einem Messer die Sehne des linken Hinterlaufs und binden ihn an einen Pflock; kein Räuber soll das Forschungsobjekt verschleppen. Einen Plastikbecher graben die Forscher auf Höhe des Kiefers ein, den zweiten platzieren sie am After. Ein wenig Wasser, ein Tröpfchen Spüli, dazu ein kleiner Plastikschirm, der vor Regen schützt – fertig sind die Insektenfallen. Jetzt stecken sie noch einen Stab mit einem Metallzylinder neben den Körper, klein wie eine Knopfbatterie. Der Data-Logger erfasst Wechsel von Feuchte und Temperatur in der Luft. Zum Schluss eine Probe des Bodens, eine Handschaufel Erde, von dort, wo das tote Tier liegt. Zuletzt zwei Abstriche mit einem Pinsel, einmal Oberkiefer, einmal unter der Zunge. Dann ziehen die Menschen sich zurück und überlassen das Wild den Fliegen.
Die haben inzwischen genug erforscht, ihre Rüssel saugen an den Wunden nach Blut. Dann wenden sie sich der Nase zu, den Augen, dem Mund und After, sie dringen auch ein, wo der Zusammenstoß von Tier und Wagen die Haut bis aufs Fleisch aufgerissen hat. Dort legen sie ihre Eier zu Zehntausenden ab, etwa 250 je Fliege. So endet der erste Tag.
»Dass Vogelbestände zurückgehen und Insekten schwinden, hat auch mit dem Fehlen von Kadavern zu tun. Unserer Landschaft fehlt der Tod.«
Der Forscher, der die Proben genommen hat, heißt Christian von Hoermann, er ist 43 Jahre alt und Doktor der Biologie. Er leitet das Projekt Kadaverökologie im Bayerischen Wald. Wanderstiefel und Arbeitshose, schwarzes Haar und braune Augen: Er könnte Förster sein, wäre da nicht seine türkise Jacke, die wie ein Warnschild leuchtet, sobald Sonnenlicht auf sie trifft. Und dann ist da noch das Latein. Er spricht von Calliphoridae und Sarcophagna carnaria, wenn er Schmeißfliegen und Fleischfliegen erklärt: Die einen kommen sofort und legen Hunderte Eier. Die anderen nehmen sich Zeit und hinterlassen nur zehn bis zwanzig Nachkommen als Brut, die wird lebend geboren.
Von Hoermann sagt, »jedes Sterben verläuft anders«, und nennt dann doch Regeln, an die der Tod sich hält. Es beginnt mit dem Fehlen von Sauerstoff. Adenosintriphosphat, ATP, der Energieträger des Lebens, wird vom Körper noch verwertet. Danach spalten Enzyme Zellen auf, so werden innerhalb einer Woche die Innereien flüssig. Bei diesem Prozess helfen Bakterien mit, beim Fuchs andere als beim Reh. Allein diese Indikatoren reichen zur Bestimmung des Todestags.
Tag 1: Die Wissenschaftler bringen einen Rehbock an der Luderstelle aus
Gelernt hat der Forscher das als Jugendlicher bei der Feuerwehr. Einmal fanden sie einen Mann – frisch verstorben, vermuteten die Polizisten. Drei Tage alt, erwiderte der Gerichtsmediziner. »Das hat mich beeindruckt«, sagt von Hoermann. »Heute gelten Kinder ja schon als seltsam, wenn sie mit einem Stock ein totes Tier erforschen.« Das sei genauso absurd wie der Wunsch nach aufgeräumten Feldern und Wiesen. »Dass Vogelbestände zurückgehen und Insekten schwinden, hat auch mit dem Fehlen von Kadavern zu tun. Unserer Landschaft fehlt der Tod.«
Hält sich die Durchschnittstemperatur im Wald bei etwa zwanzig Grad, zeigt sich am Luderplatz schon nach zwei Tagen, wie viele Wesen vom Vergehen eines einzelnen Rehs profitieren.
»Heute gelten Kinder ja schon als seltsam, wenn sie mit einem Stock ein totes Tier erforschen.«
Kadavergeruch lockt Nicrophorus, den Totengräber, über Kilometer an das Reh. Der Aaskäfer vergräbt normalerweise Kleintiere, wie Mäuse oder Singvögel, um sich ein Nest zu schaffen. Auf dem Kadaver großer Tiere frisst er Fliegeneier. Wo diese bereits geschlüpft sind, winden sich Maden wie weiße Würmer im Fleisch. Die Maden besitzen weder Zähne noch Mund, Nahrung brauchen sie flüssig. Also stoßen sie Sekrete aus, die bei der Zersetzung helfen. Die verbreiten einen süßlichen Geruch und setzen Kohlensäure frei, die im Kadaver leise gurgelt. Tausende kleine Leiber reiben aneinander, dadurch entsteht erst Wärme, dann Hitze, der tote Körper erreicht bis zu 40 Grad Celsius. Flöge eine Wärmebildkamera über den Wald, sie würde die Leiche so tiefrot abbilden wie sonst nur das Leben.
Die Maden verarbeiten das Innere des Rehs in eine graue Substanz. Gase blähen und drücken, der Bauch des Rehs schwillt an. Zwei Gramm Fleisch vertilgt eine Made, bis sie ausgewachsen ist. So endet der dritte Tag.
»Diese Viecher halten extrem viel aus«, sagt von Hoermann über die Fliegenmaden. »Man kann sie mit Ethanol überschütten oder ertränken, das macht nix.« Kolkrabe oder Wildschweine hätten eine Magensäure mit niedrigem pH-Wert, das ermögliche, sie zu verdauen. »Eine Amsel würde niemals eine Made verschlucken. Die würde sie von innen fressen.« Erste Fressspuren zeigen sich nach außen kreisrund, wie Einschusslöcher in der Haut. Aus ihnen fließt in feinen Linien Fäulnisflüssigkeit, dunkel und rot. Historiker erkennen darin den Ursprung des Vampirglaubens. Das echte Blut hat schon lange eine andere Farbe. Die Fäulnis wandelte Hämoglobin, den Farbstoff des Lebens, in Sulfhämoglobin – und das schimmert grün.

Von Hoermann mustert Kisten und Kartons, die sich in seinem Lager, einer Art Scheune, in Regalen bis zur Decke stapeln. Aus einer der Kisten zieht er eine Probe, einen Plastikbecher mit Spinnen, Käfern, Maden. »Bei Artenschwund denken viele an die Tropen«, sagt er, »aber bei den Insekten erleben wir hier längst ähnliche Effekte.«
Feldversuche der Universität Groningen geben ihm Recht: Auch aus dem niederländischen Wildnisreservat Oostvaardersplassen wurden Kadaver schnell entfernt. Als ein Forscherteam aber einige tote Rothirsche dort liegen ließ, dokumentierten sie um die Ablageplätze nach wenigen Monaten einen Zuwachs der Artenzahl um das mehr als Zweieinhalbfache.

Auch Füchse und Luchse, Falken und Adler sind angewiesen auf das Aas. Sie reißen Stücke aus dem Fleisch oder erlegen Tiere, die sich vorher an Insekten und Maden nährten. Etwa nach einer Woche haben im Reh Enzyme und Bakterien die Organe verflüssigt, die Gase blähen den Körper zu einem mit Nährstoffwasser gefüllten Ballon. Dann reißt er auf. Unter dem Kadaver sammelt sich ein dunkler Teich. Erst jetzt, wenn Sauerstoff mit dem Inneren in Berührung kommt, endet die Fäulnis und beginnt die Verwesung. Es riecht süßlich-scharf, nach überreifem Käse und eingekochtem Kohl – der Duft lockt über Kilometer zu Völlerei und Krieg.
Stutzkäfer fressen Maden und Fliegeneier. Totengräber fressen Stücke aus dem Fleisch, vertilgen auch Eier und Maden und gehen aufeinander los – sie schneiden sich Fühler und Beine ab und ringen oft bis zum Tod. Die Wespen fressen alles, Fleisch, Eier, Fliegen, Maden und Käfer. Der Teich unterm Körper versickert und verändert den Boden: Pflanzen, Mikroben, Bakterien, fast alles verendet im Nährstoffbad. In der Tiefe dünnt es sich aus und drängt in die Breite. Dadurch wächst in vier Metern Umkreis ein grüner Ring. So endet der siebte Tag.
Alle drei Tage besucht Christian von Hoermann das Reh und nimmt Abstriche vom Kiefer, einmal am Gaumen, einmal unter der Zunge, ist kein Fleisch mehr da, dann vom Knochen. Er sammelt die Insekten aus den Becherfallen ab und gräbt die Gefäße wieder ein – bisschen Wasser, Tröpfchen Spüli. Zuletzt eine Handschaufel Erde.
»Was aus 30 Kilo Tierkadaver entweicht, würde der konventionellen Landwirtschaft reichen, um die Ablagefläche für 100 Jahre zu düngen«, sagt von Hoermann. Welche Auswirkungen das hat, zeige sich entlang des Limes: Am alten Grenzwall trafen vor rund 1.500 Jahren Römer und Germanen aufeinander. Wo Leichen vergraben liegen, profitiere die Landschaft noch heute. Ob noch immer Nährstoffe übrig sind, oder sie durch das Leben und Sterben von Pflanzen an diesem Ort gebunden blieben, wisse man nicht. »Aber es wachsen mehr Bäume, Büsche, Gräser und Blumen.« Auch deswegen empfehlen Wissenschaftler:innen des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung, die EU-Regeln für Tierbeseitigung zu lockern. In einem Fachartikel von Januar 2020 fordern sie, zumindest in Naturschutzgebieten »Kadaver vor Ort verrotten zu lassen«.

Nach etwa drei Wochen ist das Fleisch vertilgt, vom Reh bleiben Knochen, Haut, Haare und Fett. Die Maden kriechen in Sammlungen ab, wie ein lebender Teppich schieben, ziehen und fallen sie über den Waldboden. Etwa acht Meter weit geht ihre Reise, dann graben sie und verschließen sich in einem braunen Kokon, der Tönnchenpuppe. Am Reh selbst landen jetzt Buckelfliegen, sie rochen einen Duft irgendwo zwischen saurer Milch und ranziger Butter – die restlichen Fette. Auch der Speckkäfer fällt über die Reste her, der Spezialist kann Haut und Haare verwerten. So endet der dreißigste Tag.
Ein paar Meter weiter saugen Wurzeln nach dem Dünger, vielleicht hilft die Energie einem Sprössling beim Wachsen: Erst schiebt sich ein Blatt aus der Erde, dann ein Stiel, irgendwann gedeiht ein Bäumchen. Zarte Triebe werden gerne gefressen von Rehen.
Erschienen am 01. April 2021
Credits für Zeitrafferaufnahmen : Janine Rietz, Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald; das Projekt ASP – Wildwissenschaftliche Untersuchungen zur Rolle von Wildschweinkadavern im Rahmen von Afrikanische Schweinepest-Ausbruchsgeschehen wird finanziert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.