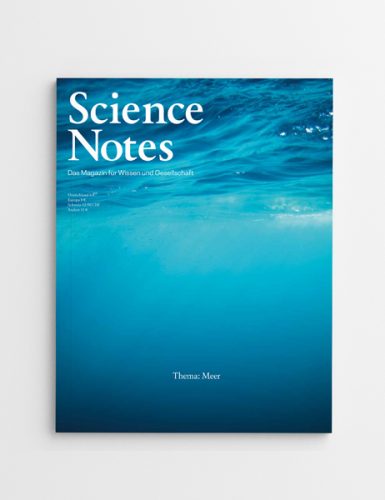Mojib Latif ist einer der bekanntesten Klimaforscher Deutschlands. Im Interview spricht er über den Klimawandel, sein Scheitern – und die Kunst, trotzdem Optimist zu bleiben.
St. Pauli, Landungsbrücken. Die Sonne strahlt, es ist ein wolkenloser Morgen in Hamburg, um die 10 Grad Celsius. Mojib Latif kneift die Augen zusammen, blinzelt in die Sonne. Er stellt sich in den Windschatten des Wartehäuschens an den Landungsbrücken. Ihn fröstelt. Eine Fähre trägt uns später die Elbe hinab Richtung Övelgönne und Elbstrand, das Brummen des Fährmotors übertönt Mojib Latif fast, wenn er spricht. Nur wenn es um die Skeptiker geht, diejenigen, die den Klimawandel immer noch anzweifeln, erhebt Latif seine Stimme.

Herr Latif, Sie sind in Hamburg geboren und aufgewachsen, Sie arbeiten als Meteorologe und Klimaforscher: Haben Sie einen Lieblingsort am Meer?
Eigentlich nicht. Ich freue mich aber, wenn ich am Wasser bin. Ich finde es toll hier in Hamburg, der Hafen bedeutet für mich Freiheit und Weltoffenheit. Die Ostsee ist auch schön, dort habe ich eine Wohnung und die Weite: bis zum Horizont nur das Meer. Es gibt auch immer etwas zu sehen, hin und wieder ein paar Schiffe, interessante Lichtspiele, bis hin zu Luftspiegelungen.
Luftspiegelungen?
Ja, auf der anderen Seite liegen die dänischen Inseln, die kann man eigentlich nicht sehen wegen der Erdkrümmung. Aber ab und zu, wenn die Temperaturverhältnisse so sind, dass auf dem Meer warme über kalter Luft geschichtet ist, werden die Lichtstrahlen gebrochen. Dann entstehen Fata Morganas. Da kann man tatsächlich die Häuser von den dänischen Inseln sehen. Das ist irre.
Sie hatten mit dem Meer ursprünglich nichts zu tun, sondern haben in Hamburg BWL studiert. Wieso sind Sie Klimaforscher geworden?
Meine Eltern meinten, ich solle etwas machen, womit man viel Geld verdienen kann. Eigentlich hatte ich keine Lust dazu, habe ein paar Semester studiert, wollte aber immer schon in Richtung Naturwissenschaften gehen. Ich fand es spannend, mir die Wolken anzugucken und hatte mir früher Theorien überlegt, wie es zu Gewittern kommt. Da dachte ich, okay, dann studierst du Meteorologie.
Wie gingen denn Ihre Theorien?
Wenn zwei große Wolken zusammenstoßen, dann rumst das, und dann gibt’s halt ein Gewitter. Klingt doch erst mal plausibel (lacht).
Heute wissen Sie das genauer – Sie sind seit mehr als 35 Jahren Klimaforscher, treten ebenso lang in Talkshows, in den Tagesthemen und in Zeitungsinterviews auf, um über den Klimawandel zu reden. Der NDR hat Sie sogar einmal als »Messias der Klimaforschung« bezeichnet. Sie selbst sagten vor Kurzem in einem Interview: »Ich wollte gern, dass der Ausstoß von Treibhausgasen sinkt. Er ist seit 1990 um über 60 Prozent gestiegen.« Was haben Sie falsch gemacht?
Ich hätte es besser machen können, offensichtlich war meine Kommunikation nicht zielführend. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Menschen durch Information, durch Wissen zum Handeln kommen. Das scheint ein ganz großer Irrtum zu sein. Menschen scheinen nicht immer rational zu handeln. Man muss auch sehen, dass man motivierende Geschichten erzählt und Emotionen weckt, unabhängig davon, wie der Stand der Wissenschaft ist. In Hamburg wird gerade diskutiert, ob die Stadt eine autofreie Innenstadt durchsetzen soll oder nicht. Da könnte man sagen: Okay, was gewinnen wir eigentlich? Saubere Luft. Es ist ruhig, wir haben wieder Platz. Menschen können sich begegnen, flanieren. Da kann doch niemand etwas dagegen haben? Man muss die positiven Aspekte viel mehr in den Vordergrund stellen. Das wird sicherlich nicht reichen, aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, anders zu kommunizieren.

Sie gingen sogar noch weiter und sagten: »Ich bin gescheitert.«
Wenn man über drei Jahrzehnte lang immer wieder darauf hinweist, dass eigentlich etwas passieren müsste und dann genau das Gegenteil passiert, nämlich, dass die CO2-Ausstöße weltweit weiter ansteigen, dann muss man sich auch mal selbstkritisch hinterfragen: Was hast du eigentlich geleistet? Außer, dass jeder inzwischen weiß, dass es ein Problem gibt.
Gibt es denn Momente in Ihrer Karriere, von denen Sie sagen: Da hätte ich etwas anders machen sollen?
Nein. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendetwas hätte anders machen können.
Eben sagten Sie noch, Ihre Kommunikation sei nicht zielführend gewesen?
Jeder hat seine Art, die Dinge zu kommunizieren. Ich werde es auch nicht mehr anders machen, auch wenn es keinen Erfolg bringt. Und ich frage mich: Bin ich derjenige, der versuchen muss, Emotionen zu wecken? Oder gibt es andere dafür, wie Fridays for Future? Insgesamt muss es eine sehr breite Bewegung aus der Zivilgesellschaft heraus geben. Am Ende des Tages bin ich Wissenschaftler und meine Aufgabe ist es, wissenschaftliche Ergebnisse zu kommunizieren. Ich glaube, das habe ich zur Zufriedenheit gemacht. Jedenfalls sind Journalisten immer wieder auf mich zugekommen und hatten wohl das Gefühl, dass ich verständlich bin und glaubwürdig, dass ich nicht irgendwelche Fake News erzähle.
Gerade in den sozialen Medien tauchen immer wieder Kommentare von Menschen auf, die anzweifeln, dass es den Klimawandel überhaupt gibt.
Die Klimaskeptiker kann man nicht überzeugen. Die argumentieren nicht seriös. Die negieren einfach, dass die Sonne schwächer geworden ist – bar jeder Rationalität. Fragen Sie sich: Wie kann eine schwächer werdende Sonne die Erderwärmung verursachen? Die wollen gar nicht überzeugt werden. Ich weiß echt nicht, was sie treibt. Klar, es gibt einige, die haben Angst um ihr Geschäftsmodell. Das verstehe ich, auch wenn ich es nicht gut finde. Die anderen sind zum Teil Verschwörungstheoretiker, die alles in Frage stellen, die sogar anzweifeln, dass die Erde eine Kugel ist. Was sind das für Menschen, die das ernsthaft glauben? Und die glauben, alles besser zu wissen, obwohl sie überhaupt keine Expertise in diesem Bereich haben, keine Ausbildung. Jetzt sehe ich das auch in der Politik, die AfD nimmt all diese Skeptiker-Argumente auf. Wie auch die Werte-Union. Die bezeichnet Klimaforschung sogar als »Junk Science«. Unfassbar. Das muss man sich mal vorstellen, da fällt mir nichts mehr ein. Ja, das ist die heutige Zeit, das Internet und die sozialen Netzwerke spielen da eine große Rolle.
Dabei haben Sie mal behauptet, Sie seien ein hemmungsloser Optimist. Ist Ihnen in den vergangenen Jahren etwas Optimismus verloren gegangen?
Ich bin immer noch Optimist! Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Menschheit die Erde gegen die Wand fährt. Die Vergangenheit zeigt doch, dass ganz unerwartete Dinge passieren können. Bestes Beispiel: die deutsche Wiedervereinigung. Warum ist es dazu gekommen? Weil die Menschen es wollten. Wenn die Menschen etwas wirklich einfordern, dann passiert es auch – im Kleinen wie im Großen. Der Hambacher Forst bleibt, der Atomausstieg kommt, weil die Menschen früher dagegen demonstriert haben.

Manche Ihrer Kolleginnen und Kollegen scheinen nicht so optimistisch zu sein. Ein Australier hat Briefe von renommierten Klimaforschern weltweit gesammelt. Darin schreiben sie, wie sie sich fühlen, wenn sie an den Klimawandel denken. Ihr Kollege Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beschreibt einen Albtraum: Er träume von einem brennenden Haus, zu dem die Feuerwehr nicht kommt, weil sie den Anruf nicht ernst nimmt. Wovon träumen Sie nachts?
Nee, bestimmt nicht davon (lacht). Ich kann da gut unterscheiden, so wie bei einem Arzt-Patienten-Verhältnis. Wenn ich mich mit dem Klimawandel beschäftige, nehme ich Anteil. Aber wenn die Sprechstunde zu Ende ist, ist sie zu Ende.
Die Denkfabrik Agora Energiewende hat in der Diskussion um den Klimawandel neue Zahlen eingebracht: Demnach ist der CO2-Ausstoß in Deutschland im Vergleich zu 1990 insgesamt um 35 Prozent gesunken, sieben Prozent im Vergleich zu 2018. Das ist doch auch für Sie ein Erfolg?
Das lag vor allem daran, dass der Preis für CO2 im Rahmen des europäischen Emissionshandels hochgegangen ist. Deswegen wurde Kohle unrentabel und Gas rentabler. Wir leben in einer monetären Welt, der Hebel ist natürlich das Geld. Es kann ja nicht angehen, dass man die Umwelt verpestet, ohne dafür einen Preis zahlen zu müssen. Wo gibt es denn sowas? Ich hätte mir aber gewünscht, dass die Bundesregierung einen deutlich höheren CO2-Preis festgelegt hätte. Natürlich hätte es einen sozialen Ausgleich geben müssen, das hätte man über eine Klima-Prämie lösen können.
Eine Studie von 14 Forschenden aus elf Instituten verschiedener Länder zeigt: Die Meere wiesen in den vergangenen fünf Jahren die höchsten Temperaturen seit den 1950er-Jahren auf. In Ihren Aufsätzen und Büchern haben Sie schon vor Jahren vor einer Erwärmung des Meeres gewarnt. Sie könnten der Bundesregierung sagen: Ich habe es euch schon immer gesagt.
Es wäre schön gewesen, wenn das Wissen zum Handeln geführt hätte. So, wie es ja in der Vergangenheit schon passiert ist. Nehmen wir das Waldsterben: Das haben wir verhindert, weil wir den sauren Regen abgeschafft haben durch die Rauchgas-Entschwefelung und die Katalysatoren in Autos. Es gibt Erfolgsgeschichten, aber die passieren meistens nur, wenn die Leute direkt betroffen sind. Damals, in den 70er-, 80er-Jahren, gab es Smog ohne Ende. Die Menschen sind krank geworden, die Bäume sind gestorben. Es war klar: Irgendetwas muss passieren. Und dann hat die Politik gehandelt. Das Gleiche gilt für das Ozonloch. Wissenschaftler haben gewarnt und die Wirtschaft hat gesagt: »Ach, man muss nicht alles glauben, was die Wissenschaftler sagen.« Dann hat man das Ozonloch entdeckt und alles ging rasend schnell. Aber das war einfacher als bei der Erderwärmung, weil es nur ein paar Unternehmen gab, die die schädlichen FCKWs produzierten. Und diese Unternehmen hatten auch schon die Ersatzstoffe parat und konnten von einem Geschäftsmodell aufs andere umsteigen.
Laut Weltklimarat haben seit 1970 die Ozeane 90 Prozent der zusätzlichen Wärmeenergie aufgenommen. Eine Studie vergleicht diese Wärmeenergie mit der Explosion von 3,6 Milliarden Hiroshima-Bomben.
In dieser Studie geht es um die oberen 2.000 Meter, die haben sich jetzt zwar »nur« um 0,075 Grad erwärmt. Aber Sie müssen überlegen: Der Ozean fasst ein Volumen, zwei Drittel der Erdoberfläche. Wenn sich so ein Volumen um 0,075 Grad erwärmt, das ist eine wahnsinnige Energiemenge und das hat Konsequenzen. Wenn sich Wasser erwärmt, dehnt es sich aus, alleine dadurch steigt der Meeresspiegel. Wärmeres Wasser neigt auch zu Sauerstoffarmut. Unsere Lebensgrundlagen liegen in den Meeren und wenn wir die Meere schädigen, dann sägen wir auch den Ast ab, auf dem wir sitzen.
Die Meere nehmen etwa ein Viertel des Kohlenstoffdioxids auf, das wir Menschen ausstoßen. Sie haben einmal das Klima mit einem Schnellzug verglichen, bei dem man die Notbremse ziehen müsse: Das Klima sei träge, die Ozeane ebenso. Haben wir noch eine Chance, diese Notbremse zu ziehen?
CO2 geht keine Verbindungen in der Luft ein und besitzt deswegen eine lange Verweildauer in der Atmosphäre von circa hundert Jahren. Das heißt, was unsere Eltern und Großeltern in die Luft geblasen haben, das ist alles noch da oben. Wir haben nur eine Möglichkeit, die Erderwärmung relativ schnell zu stoppen: den Ausstoß von CO2 drastisch zu verringern und schnell auf null Emissionen zu kommen. Dann würden die natürlichen Senken das CO2 allmählich aus der Luft entfernen: das Meer vor allem, aber auch die Landregionen. Eigentlich haben wir das in der Hand. Es ist ja nicht gottgegeben, dass wir CO2 ausstoßen müssen. Es liegt wirklich nur an der Menschheit.
Erschienen am 28. Mai 2020