Gibt es Unterschiede zwischen den Gehirnen von Männern und Frauen? Nein, sagt die Neurowissenschaftlerin Lise Eliot. Ein Gespräch über Hirntransplantation, Neurosexismus und Kindererziehung.
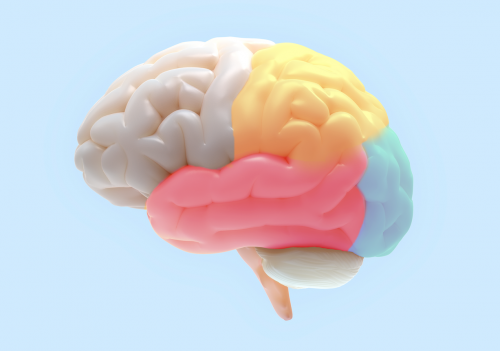
Frau Eliot, angenommen, wir könnten Gehirne transplantieren, so wie eine Lunge oder eine Niere. Könnten wir dann das Gehirn eines Mannes in den Körper einer Frau transplantieren?
Lise Eliot: Das wäre ein interessantes Experiment! Wenn das möglich wäre, würde sich das Gehirn mit der Zeit verändern. Und wenn es das Gehirn eines Mannes wäre, dann würde es sich an den Frauenkörper anpassen. Das Vorhaben könnte durchaus gelingen, denn die Gehirne von Männern und Frauen sind meist recht ähnlich. Beobachten können wir das in gewisser Weise bei Transpersonen, wenn sie im Rahmen einer Transition, also einer Geschlechtsangleichung, Hormone nehmen. Dadurch verändern sich der Körper, die Stimme und auch das Gehirn.
Weil das ursprünglich weibliche Gehirn durch die Gabe von Hormonen männlicher wird? Oder weil es sich an den Körper anpasst, der sich verändert?
Beides könnte eine Rolle spielen, obwohl die genauen Auswirkungen der Hormonbehandlung auf wenigen Studien beruhen und ziemlich widersprüchlich sind. Ich neige zu der Annahme, dass sich das Gehirn an den sich verändernden Körper anpasst, unabhängig vom Geschlecht. Die Transition ist ein äußerst bedeutsames Ereignis im Leben dieser Menschen.
Extreme Ereignisse führen zu Veränderungen im Gehirn?
Das ist fast immer der Fall. Ein typisches Beispiel dafür sind Veränderungen im Gehirn, wenn Menschen zum ersten Mal Eltern werden. Und bei der Transition verändert sich die komplette Identität der Transpersonen. Dadurch verändern sich auch die Reaktionen aus dem Umfeld: Die Menschen sprechen anders mit ihnen, sie werden anders angesehen und ihre Beziehungen verändern sich. Ich wäre eher überrascht, wenn es da keine Effekte im Gehirn geben würde. Denn wir sind ein Produkt unserer sozialen Erfahrungen. Unser Gehirn ist plastisch. Auch wenn wir schon erwachsen sind, kann es sich noch verändern.
Welche Rolle spielen Hormone in den Gehirnen von Männern und Frauen?
Sowohl bei Männern als auch bei Frauen finden wir die Sexualhormone Östrogen, Progesteron und Testosteron im Gehirn. Nur die Level sind bei den Geschlechtern unterschiedlich. In der Vergangenheit wurde viel zur Wirkung von diesen Hormonen auf Gehirnfunktionen geforscht. Doch die unterschiedlichen Effekte, die Östrogen und Testosteron auf das Gehirn haben, waren laut Studien winzig. Ich denke, die Menschen haben ihre Resultate künstlich aufgeblasen.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Östradiol, ein Östrogen, soll zum Beispiel neuroprotektiv sein, also das Gehirn schützen. In einer Studie zeigte sich zum Beispiel, dass sich höhere Östradiol-Level von Frauen in der Menopause positiv auf die Gedächtnisleistung auswirken. Tierstudien haben außerdem gefunden, dass eine höhere Östrogenkonzentration vor neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer schützt. Daraufhin wurden große experimentelle Studien aufgezogen, mit vielen Probandinnen und Probanden. Doch sie fanden eher das Gegenteil: Die zusätzliche Gabe von Östrogenen erhöhte eher das Risiko, an Alzheimer zu erkranken.
Und Testosteron, macht das nicht aggressiv?
Um Testosteron ranken sich einige Mythen, zum Beispiel dass es umgehend nach der Gabe aggressiv macht. Das tut es aber höchstens, wenn es in enorm hohen Dosen verabreicht wird. Entgegen der weit verbreiteten Annahme führen höhere Level an Testosteron auch nicht dazu, dass sich die kognitiven Fähigkeiten verbessern. Nur eine Evidenz zeigt sich konsistent: dass Testosteron den Sexualtrieb verstärkt. Daher bekommen manche Frauen ein Testosteron-Pflaster, wenn sie eine schwache Libido haben.
2021 veröffentlichten Sie mit Kolleginnen die Meta-Analyse »dump the dimorphism« – den Dimorphismus wegschmeißen. Dafür analysierten Sie hunderte Studien aus drei Jahrzehnten der Hirnforschung. Eine Ihrer Schlussfolgerungen lautet: Das menschliche Gehirn ist nicht »sexuell dimorph«. Gibt es wirklich gar keine Unterschiede zwischen den Gehirnen von Männern und Frauen?
Männliche Gehirne sind von Geburt an im Schnitt größer als weibliche. Dieser Größenunterschied beträgt im Erwachsenenalter circa elf Prozent. Er erklärt viele Befunde, von denen man glaubte, sie seien geschlechtsspezifisch. Zum Beispiel, dass größere Gehirne proportional mehr weiße Substanz haben. Oder dass sie eher innerhalb der Gehirnhälften vernetzt sind und nicht so sehr dazwischen. Allerdings sind diese beiden Beispiele nicht die Art von »sexuellem Dimorphismus«, der Neurowissenschaftlerinnen normalerweise interessiert.Die Suche nach sexuellen Dimorphismen im menschlichen Gehirn beruht vielmehr auf der Annahme, dass sich bestimmte Strukturen oder Schaltkreise zwischen Männern und Frauen überproportional unterscheiden. Die Idee dabei ist, dadurch bestimmte Verhaltensunterschiede zwischen Männern und Frauen erklären zu können. Daher war zum Beispiel die Amygdala besonders interessant für die Forscherinnen.
Warum?
Die Amygdala spielt eine entscheidende Rolle beim Erleben von Emotionen. Forscherinnen waren also überzeugt, dass sich da ein Geschlechterunterschied zeigen müsste, das passte einfach sehr gut in ihr Weltbild. In unserer Meta-Analyse fanden wir aber keinen Geschlechterunterschied mehr, sobald wir den Größenunterschied zwischen den Gehirnen beachteten. Das gilt für alle Strukturen – rechnet man ihn heraus, lassen sich männliche und weibliche Gehirne nicht mehr unterscheiden.
Könnten die elf Prozent Größendifferenz denn keine Unterschiede im Verhalten und Erleben erklären?
Nein. Aber um das zu verstehen, muss man sich zwei Dinge klar machen. Erstens: Das Gehirn der Männer ist nur im Schnitt größer als das der Frauen. Das lässt sich vor allem dadurch erklären, dass Männer meist größer sind als Frauen. In der Regel haben größere Körper größere Köpfe, größere Torsi und größere Gliedmaßen, die allesamt größere Gehirne erfordern.
Und zweitens?
Es gibt ein paar wenige Unterschiede, die sich durchgängig zeigen, wenn es um die Fähigkeiten von Männern und Frauen geht. Im Schnitt sind Männer besser im räumlichen Vorstellungsvermögen und Frauen sind sprachlich stärker. Dies ist jedoch meist auf mehr Übung zurückzuführen. Denn wäre die Größe des Gehirns verantwortlich für diese Unterschiede, dann müssten kleine Männer aufgrund ihres kleineren Gehirns besser sein, was sprachliche Fähigkeiten angeht. Große Männer wären dafür besser beim räumlichen Denken.
Das hat sich aber nicht gezeigt?
Nein. Ich denke, das Gehirn zwischen Mann und Frau ist nicht unterschiedlicher oder ähnlicher als das zwischen zwei willkürlich ausgesuchten Individuen. Die Neurowissenschaftlerin Daphna Joel sagt, Geschlecht ist ein Mosaik, das finde ich sehr treffend.

Was meint sie damit?
Sie führte mit Kolleginnen 2015 eine Studie durch, für die sie über 1.400 Kernspin-Aufnahmen von Gehirnen analysierte. Sie fanden, dass es bei allen untersuchten neuronalen Strukturen große Überschneidungen zwischen Frauen und Männern gab. Laut Joel bestehen Gehirne aus einzigartigen »Mosaiken« von Merkmalen. Manche Merkmale kommen häufiger bei Frauen vor als bei Männern. Andere bei Männern häufiger als bei Frauen. Und dann gibt es noch solche, die sowohl bei Frauen als auch bei Männern vorkommen. Joel und ihre Kolleginnen befragten die Teilnehmerinnen außerdem nach Persönlichkeitsmerkmalen, Einstellungen, Interessen und Verhaltensweisen. Dabei zeigten sich, in Übereinstimmung mit den Gehirnscans, große Überschneidungen zwischen Frauen und Männern.
Wie würden Sie diese Befunde interpretieren?
Joel spricht da von relativer Maskulinität oder relativer Feminität, und zwar auf vielen verschiedenen Dimensionen. Wir als Gesellschaft gehen zum Beispiel davon aus, dass enge und emotionale Beziehungen eher weiblich sind. Ein stereotypisch weiblicher Charakter wäre eher sozial und empathisch. Rationales, analytisches Denken stufen wir eher als männlich ein. Dabei kann eine Person sehr »feminin« sein in der Art, sich zu kleiden, und sehr »maskulin« in der Art, wie sie denkt. Ihre Beziehungen können eher weiblich sein, aber ihre Interessen eher männlich. Wir denken leider sehr stark in Kategorien, während meiner Meinung nach das Geschlecht ein Spektrum oder viele Spektren ist, wie das Mosaik, das Daphna Joel beschreibt.
Warum ist der Gedanke, dass weibliche und männliche Gehirne sich grundlegend unterscheiden, für viele Menschen so attraktiv?
Menschen finden sexuelle Dimorphismen sind ein großer Spaß. Sie finden die Idee toll, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. 2014 wurde eine Studie von der Neurowissenschaftlerin Madhura Ingalhalikar und Kolleginnen in einem sehr renommierten Journal publiziert, die behauptete, dass Männer und Frauen unterschiedlich stark vernetzte Gehirnhälften haben. Wobei die Autorinnen schrieben »Männer und Frauen«, dabei waren die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer im Schnitt erst 13 Jahre alt. Sie fanden also eine stärkere Vernetzung innerhalb der Gehirnhälften bei den Jungen und eine größere Vernetzung zwischen den Gehirnhälften bei den Mädchen. Allerdings sind diese Unterschiede in Wirklichkeit auf die Größe des Gehirns und den früheren Eintritt der Mädchen in die Pubertät zurückzuführen.
Welche Schlüsse zogen die Autorinnen aus den Ergebnissen der Studie?
Sie behaupteten, die Unterschiede bezüglich der Vernetzung wären ein Beleg dafür, dass Frauen besser im Multitasking seien und Männer besser darin, sich auf eine Sache zu fokussieren. Sie nannten das, was sie da fanden, »Komplementarismus«, also dass sich die beiden Geschlechter ergänzen. Weiter schrieben sie, dass die Evolution diese komplementären Gehirn-Stile hervorgebracht hätte. Aber im Ernst, diese Idee klingt wie aus der Bibel: Die Frau ist die Ergänzung des Mannes. Diese Wissenschaftlerinnen benutzen ihre Neuroimaging-Daten und interpretieren sie so, dass sie Stereotype unterstützen.
Sie haben in der Vergangenheit den Begriff »Neurosexismus« benutzt, wenn Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Gehirnen als Erklärung für die Unterlegenheit von Frauen angeführt wurden. Würden Sie sagen, dieser Begriff trifft auch bei der Interpretation der Ergebnisse dieser Studie zu?
Absolut. Hier wird die Wissenschaft benutzt, um schon bestehende Statusunterschiede zwischen Männern und Frauen zu untermauern. Das ist Sexismus. Das ärgert mich besonders, weil es im Fall dieser Studie auch noch falsch ist. Denn wenn es um die unterschiedliche Vernetzung der beiden Gehirnhälften bei Männern und Frauen geht, dann ist die adäquate Erklärung eben die Größe des Gehirns. Doch die haben die Autorinnen dieser Studie bei der Auswertung gar nicht berücksichtigt.
Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, zu untersuchen, ob es Unterschiede zwischen dem männlichen und dem weiblichen Gehirn gibt?
Das begann, als ich Mutter wurde. Bis dahin arbeitete ich als Neurowissenschaftlerin eher auf der molekularen Ebene. Als ich meine Kinder aufwachsen sah, begann ich mich für die Entwicklung des Gehirns zu interessieren. Ich habe drei Kinder, ein Mädchen und zwei Jungen, die mittlerweile alle schon erwachsen sind. Das Thema Genderunterschiede ist immer sehr brisant in der Kindererziehung. Vor 20 Jahren waren die bildgebenden Verfahren in der Neurowissenschaft noch ganz am Anfang. Man glaubte fest an den sexuellen Dimorphismus, dass die Gehirne von Männern und Frauen grundlegend verschieden sind, der sich ein wenig auf die Forschung an Tieren stützte. Warum sonst sollten Frauen empathischer sein und Männer gerne Autos reparieren? Dass wir glaubten, männliche und weibliche Gehirne würden sich unterscheiden, das passte zu den Stereotypen.
Und diese Stereotype wollten Sie nicht einfach so hinnehmen?
Ich wollte herausfinden, was tatsächlich von Geburt an vorhanden und was erlernt ist. Was kann man fördern? Klar ist, Kinder lernen schon sehr früh den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Kleinkinder können männliche und weibliche Gesichter und Stimmen unterscheiden. Das Geschlecht ist ein wichtiger Teil der Sprache und bestimmt auch, wie wir mit Kindern sprechen. Wir haben verschiedene Wörter, die wir bei der Kommunikation mit Jungen und Mädchen benutzen. Wir haben einen anderen Ton, andere Gesten und andere Erwartungen an Mädchen und Jungen. Und das heißt, die Kinder machen schon sehr früh sehr unterschiedliche Erfahrungen. Daraus resultieren meiner Meinung nach sehr viele Geschlechterunterschiede. Geschlecht ist, wie Sprache, erlernt.
Welche Geschlechterunterschiede wären das?
Relativ konsistent zeigt sich, dass Mädchen, wie bereits erwähnt, sprachlich stärker sind und Jungen in der räumlichen Vorstellung. Interessanterweise ist dieser Geschlechterunterschied deutlicher, wenn man ihn zu Beginn eines Schuljahres untersucht. Über die Sommerferien, wenn die Kinder nicht geleitet werden, lesen Mädchen mehr, das trainiert die sprachlichen Fähigkeiten. Jungen spielen Videospiele, dadurch wird ihre räumliche Vorstellung besser. Erhebt man die Geschlechterunterschiede hingegen am Ende des Schuljahres, sind diese deutlich geringer. Die Kinder werden durch Schularbeiten darauf trainiert, sich in den Fähigkeiten ähnlicher zu werden. Letzten Endes haben die Fähigkeiten unseres Gehirns immer mit Training und Übung zu tun.
Das heißt, wir können bei unseren Kindern dafür sorgen, dass die Geschlechterdifferenzen geringer werden?
Ja und bei den Mädchen hat das schon recht gut funktioniert. In den vergangenen Jahren haben wir ihnen erlaubt, alles zu machen, sie mit extra Sportprogrammen und Mathe-Kursen gefördert und sie für die MINT-Fächer motiviert. Diese Programme fruchten langsam, Frauen studieren Medizin, werden Chirurginnen oder Ingenieurinnen.
Und Jungen?
Im Gegensatz dazu gibt es keine Förderprogramme, um Jungen für soziale Berufe zu motivieren. Eher das Gegenteil ist der Fall. Wenn sie typische Mädchensachen machen, wie Lesen oder Tagebuch schreiben, werden sie stigmatisiert. Und als weiblich angesehen zu werden, ist tendenziell negativ besetzt. Deshalb meiden sie es. Und es stimmt, dass typisch weibliche Berufe schlechter bezahlt werden und weniger Status haben. Aber wir brauchen mehr Möglichkeiten für Jungen. Das Ziel wäre also, auch mehr Jungen zu ermutigen, Berufe wie Erzieher, Floristen oder Zahnarzthelfer zu ergreifen.
Sie wussten also sehr viel darüber, wie man Kinder am besten erzieht. Hat Sie das bei der Erziehung ihrer eigenen Kinder gestresst?
Wahrscheinlich hat es mich schon mehr gestresst, als wenn ich mich einfach auf rosa und blaue Klischees eingelassen hätte. Aber ich bin froh, dass ich darauf geachtet habe. Alle unsere Kinder haben eine sehr offene Einstellung zum Thema Geschlecht und denken stark feministisch. Die drei arbeiten heute alle in traditionell männlichen Bereichen: Meine beiden Söhne sind Ingenieure, einer arbeitet im Bereich Maschinenbau und einer in der Luftfahrt. Meine Tochter ist Architektin.