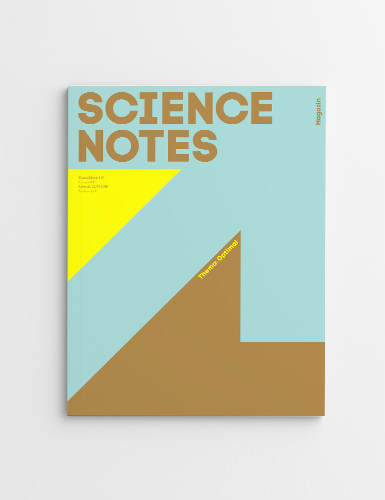Wie wir uns entscheiden und warum nicht.
Täglich treffen wir bewusst oder unbewusst etliche Entscheidungen. Doch die Wahl fällt oft schwer und ist nicht immer die beste. Denn viele psychologische Fallstricke erschweren die Suche nach der optimalen Entscheidung.
Von 50 Zahnbürsten im Laden die richtige kaufen, aus fünf tollen Plänen fürs Wochenende den besten herauspicken und unter all diesen Menschen den perfekten Partner finden: Wir haben die Wahl. Multioptionalität ist eines der Stichwörter unserer Zeit. Es könnte immer alles anders, besser sein, wenn wir uns nur richtig entscheiden. Aber wer wählen kann, der kann auch daneben liegen–Entscheidungen sind anstrengend und fehleranfällig. Auf der Suche nach der optimalen Wahl lohnt sich ein Sprint durch die Forschung.
Ökonomen und Mathematiker hatten auf die Frage nach der optimalen Entscheidung lange eine eindeutige Antwort: Optimal ist eine Entscheidung, wenn man alle Alternativen bedenkt – samt Eintrittswahrscheinlichkeiten aller möglichen Konsequenzen – und dann nach genauer Berechnung die Alternative mit dem größtmöglichen Nutzen wählt. Richtige Entscheidungen konnte man, laut Wissenschaft, quasi ausrechnen. Doch inzwischen haben Psychologen, Verhaltensökonomen und Spieltheoretiker erkannt, dass die Sache etwas komplizierter ist.
Pi mal Daumen
Als König unter den modernen Entscheidungsforschern gilt der Psychologe Daniel Kahneman. Zusammen mit Amos Tversky hat er die Annahmen der klassischen Entscheidungstheorie zutiefst ins Wanken gebracht–und dafür 2002 den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. Sein Befund: Um exakt zu kalkulieren, fehlt es uns an kognitiven und zeitlichen Kapazitäten. Daher verlassen wir uns auf Daumenregeln, sogenannte Heuristiken. Etwa ‚Vertraue Experten‘, ‚Tue, was andere machen‘ und ‚Schätze eine Wahrscheinlichkeit anhand dessen, wie prototypisch etwas wirkt‘. „Im Grunde sind diese Daumenregeln ziemlich nützlich, aber manchmal führen sie zu schwerwiegenden und systematischen Fehlern“, schrieben Kahneman und Tversky 1974 in einem bahnbrechenden Science-Artikel. Experten haben eben nicht immer recht, Mehrheiten können sich irren und Stereotype haben oft einen wahren Kern, treffen aber nicht immer zu.
Eine Heuristik, die uns häufig in die Irre führt, ist die Verfügbarkeitsheuristik. Sie besagt, dass wir Alternativen oft anhand dessen bewerten, was uns als erstes einfällt. Heuristiken sind wie alle Daumenregeln effizient. Neurowissenschaftler wie Gregory Berns haben bestätigt, dass sie das Gehirn entlasten. Doch die Verfügbarkeitsheuristik führt uns immer dann in die Irre, wenn Informationen, die uns rasch einfallen, nicht annähernd repräsentativ sind. So erscheint uns beispielsweise die Gefahr eines Flugzeugabsturzes wegen zahlreicher Medienbilder viel realer als die Möglichkeit, sich beim Essen im Flugzeug zu verschlucken und zu ersticken. „Risikoparadox“ nennt das der Stuttgarter Soziologe Ortwin Renn.
Wenn wir diesem Paradox nicht aufsitzen wollen, sollten wir nicht nur eingehender nach Informationen suchen, sondern dabei besonders auf Informationen achten, die unserem eigenen Anfangsbild widersprechen. Denn normalerweise nehmen wir besonders Dinge wahr, die unsere bisherigen Meinungen und Erfahrungen bestätigen (daher spricht man vom Bestätigungsfehler). Widersprüchliches wird hingegen ignoriert oder verworfen. Laut dem Bamberger Psychologen Dietrich Dörner kann das dazu führen, dass Weltbild und Realität sich immer weiter voneinander entfernen.
Bauchentscheidungen und die Angst vorm Scheitern
Auch sonst entscheiden wir uns häufig dafür, nichts zu ändern. Wie ebenfalls Kahneman und Tversky entdeckt haben, gewichten wir bei Veränderungsentscheidungen die möglichen Verluste etwa doppelt so stark wie die erwarteten Gewinne („losses loom larger than gains“). Und die Gewinne sind zudem häufig ungewiss. Daher bleiben wir oft lieber beim Ist-Zustand. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Verlustabneigung und Status-Quo-Effekt können sich in vielen Bereichen negativ auswirken: politische Reformen bleiben aus, Innovationen werden nicht umgesetzt, Anleger verkaufen verlustreiche Aktien nicht.
„Scheitern muss enttabuisiert werden, um die Intuition zu verbessern.“
Gerd Gigerenzer
Dass wir Entscheiden regelrecht üben sollen, meint auch der Intuitions-Forscher Gerd Gigerenzer: „Scheitern muss enttabuisiert werden, um die Intuition zu verbessern.“ Bauchentscheidungen machen laut Studien oft glücklicher als Kopfentscheidungen. Doch sie führen nur dann zu einer optimalen Entscheidung, wenn wir durch Erfahrungen eine gute Intuition entwickeln konnten. Das geht auch durch Erfahrung von anderen: So erfreuen sich unter Gründern sogenannte Fuck up-Nights großer Beliebtheit. Auf den Abendveranstaltungen, berichten gescheiterte Entrepreneure von ihren Fehlern. Man kann aber auch ins Kino gehen: Filme regen dazu an, Entscheidungen hypothetisch zu proben.
Intuition ist also nur auf Basis von Erfahrungen wirklich zuverlässig. Ansonsten sind unbewusste Entscheidungen anfällig für Manipulation und Inkonsistenz: So kaufen wir im Supermarkt mehr französischen Wein, wenn französische Musik läuft, und sind anderen gegenüber spendabler, wenn wir satt sind.
Gerade bei schnellen Entscheidungen kommen wir aber um Intuition nicht herum. Ebenso bei sehr komplexen Entscheidungen, bei denen wir nicht rational genau kalkulieren können oder es zu viele Alternativen gibt.
Satisficing: Gar nicht erst nach dem Optimalen suchen
Einen anderen Weg, um mit komplexen Entscheidungen umzugehen, hat der Sozialwissenschaftler (und ebenfalls Nobelpreisträger) Herbert Simon vorgeschlagen: das Satisficing. Dabei geht es im Grunde darum, gar nicht erst die optimale Entscheidung zu suchen, da es zu aufwendig oder nicht machbar ist. Simon plädiert für eine möglichst gute Entscheidung bei vertretbarem Aufwand. Der bekannteste Satisficing-Weg besteht daher darin, sich einen Standard zu setzen und nur so lange zu suchen, bis man etwas gefunden hat, das dem Standard entspricht. Bei der Wohnungssuche kann man beispielsweise nicht alle freien Wohnungen in der Stadt besichtigen. Ein Satisficer gibt sich stattdessen mit einer Wohnung in einem bestimmten Stadtteil zu einer gewissen Miete zufrieden, egal ob sie auch Balkon, Badewanne und Autostellplatz hat oder nicht.
Entscheide dich, egal wofür, statt dich überhaupt nicht zu entscheiden.
Dass man oft besser gar nicht alle Alternativen bedenkt und bewertet – wie es die klassische Entscheidungstheorie vorschreibt–, zeigt sich auch an einem inzwischen zum Klassiker gewordenen Feldexperiment: Dabei konfrontierten Wissenschaftler Supermarktkunden mit einem Produkttest: Konnten Kunden sechs Marmeladensorten probieren, kauften dreißig Prozent der Testenden anschließend ein Glas. Hatten die Kunden aber 24 (!) Sorten zur Wahl, kauften nur drei Prozent eine Sorte. Die anderen entschieden sich lieber dafür, sich nicht zu entscheiden. Denn eine Sorte zu wählen, bedeutet auch alle anderen auszuschließen–und deren Vorzüge. Ein Fazit daraus lautet: Weniger ist manchmal mehr. Und: das Bessere ist der Feind des Guten.
Ein zweites Fazit lautet: Entscheide dich, egal wofür, statt dich überhaupt nicht zu entscheiden. Das legt auch die Forschung des Verhaltensökonomen Dan Ariely nahe. In seinem Computer-
Experiment mit virtuellen Räumen, in denen Gewinne lockten, versuchten viele Teilnehmer, sich im wahrsten Sinne des Wortes alle Türen offen zu halten, obwohl der Gewinn am höchsten gewesen wäre, wenn sie einfach in irgendeinem Raum geblieben wären. „Dahinter steckt vor allem Verlustangst und weniger der Wunsch nach Flexibilität“, schreibt Ariely.
Allerdings sollte man nicht immer bei einmal getroffenen Entscheidungen bleiben. Nur wegen einmal investierter Kosten (sogenannter Sunk Costs) nichts zu ändern, kann auch nach hinten losgehen–etwa wegen geleisteter Überstunden im verhassten Job zu bleiben oder wegen langer Paartherapie eine nicht funktionierende Ehe aufrecht zu erhalten.
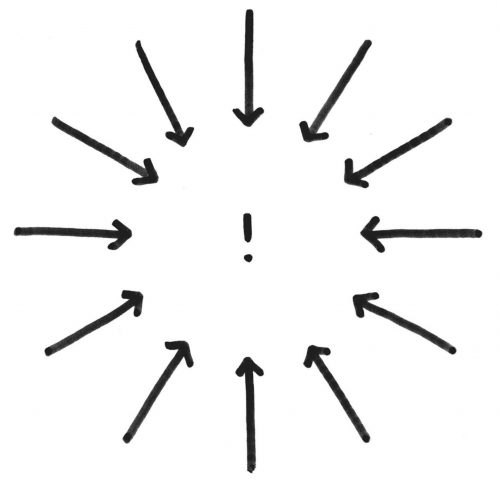
Geld oder Gerechtigkeit: Was wollen wir maximieren?
Ob eine Entscheidung optimal ist oder nicht, hängt von dem eigenen Nutzen ab. Für Ökonomen der klassischen Entscheidungstheorie bedeutet das in der Regel Geld. Evolutionstheoretiker sehen den Nutzen hingegen in der Optimierung der Genweitergabe. Für Psychologen bedeutet Nutzen wiederum meist Glück; gut ist, was Bedürfnisse wie soziale Zugehörigkeit und Freiheit befriedigt.
Dass nicht immer Geld im Vordergrund steht, zeigen Experimente aus der Spieltheorie. Beispielsweise das Diktatorspiel. Dabei erhält eine Person A einen gewissen Geldbetrag und kann entweder den vollen Betrag behalten oder etwas davon (oder alles) an eine ihr unbekannte Person B abgeben. Aus Sicht der klassischen Theorie wäre es rational, alles zu behalten; schließlich kann Person B nicht sanktionieren. Doch in der Praxis bietet sich ein sehr anderes Bild: Im Durchschnitt geben die Diktatoren 28 Prozent des Geldes ab, wie 2011 eine Meta-Studie ergab. Als wesentliche Erklärung gelten Gerechtigkeitssensitivität und eine Abneigung gegen Ungleichheit. Die Großzügigkeit der Diktatoren mag auch etwas damit zu tun haben, dass diese ihren Untergebenen langfristig Anreize zur Kooperation geben wollen. Ob hinter scheinbarem Altruismus nicht doch Egoismus steckt, darüber streiten sich Wissenschaftler noch heute.
Durch Kommunikation bessere Entscheidungen treffen
In ähnlicher Weise gilt Kooperation im spieltheoretischen Gefangenendilemma als die gemeinschaftlich rationale Strategie–nicht aber als individuell rationale: Im Gefangenendilemma geht es darum, dass zwei Gefangene einzeln und simultan verhört werden. Leugnen sie das Verbrechen, kann ihnen mangels Beweisen nur eine geringe Strafe angehängt werden. Doch beide bekommen das Angebot, zu gestehen und den anderen zu „verpfeifen“. Der Geständige würde dann straffrei ausgehen, während der Verpfiffene die Höchststrafe erhält. Gestehen allerdings beide, bekommen beide eine mittlere Strafe. Individuell ist es in dieser Situation stets besser, zu gestehen (wenn der andere schweigt, geht man straffrei aus; gesteht der andere, erhält man nur eine mittlere Strafe). Dabei hätten sie zusammen die geringste Strafe, wenn beide miteinander kooperierten und das Verbrechen leugneten.
Das theoretische Dilemma lässt sich auf reale Situationen wie Aufrüsten zwischen Nationen und Revolten gegen Diktatoren übertragen. Erst durch Kommunikation und vor allem durch Wiederholung und damit Reputation erhöht sich die Wahrscheinlichkeit zur Kooperation.
Entschieden: zufrieden!
Entscheidungen sind komplex. Je nachdem, worum es geht, sind unterschiedliche Strategien gefragt. In manchen Situationen ist es vielleicht gut, wenn wir alle Optionen akribisch durchrechnen, in anderen hört man besser auf das Bauchgefühl. Wer gute Entscheidungen treffen will, muss das üben und dabei seine eigenen Ansichten und Intuitionen stets selbstkritisch hinterfragen, ehe er bei einer Fülle an verschiedenen Möglichkeiten eine Wahl trifft. Eine ist besser als keine. Zufriedener machen uns Entscheidungen letztlich, wenn wir sie im Nachhinein nicht in Frage stellen und andere Optionen bedenken, so zumindest eine Studie von Daniel Gilbert und Jane Ebert: Am liebsten würden wir uns alle Optionen offen halten und uns nicht festlegen. Glücklicher sind wir aber mit Entscheidungen, wenn wir gar nicht die Möglichkeit haben, es uns anders zu überlegen.
Erschienen am 18. März 2018