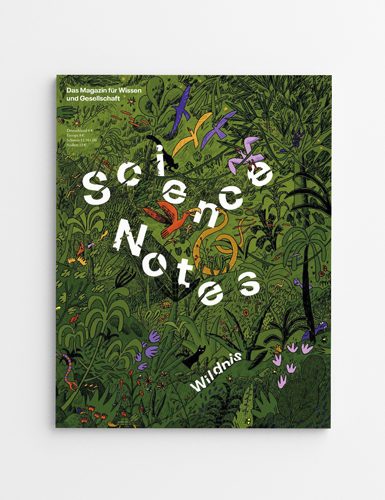Zwei Menschen verlaufen sich, halluzinieren und gehen über ihre Grenzen hinaus. Sie wollen Rennen gewinnen, für die es kein Preisgeld gibt. Danach sind sie nicht mehr dieselben.
Tennessee. Der Nebel nimmt den Dingen ihre Bekanntheit. Er hüllt die Berge in ein undurchdringliches Weiß und die Gedanken in Traumwelten. John Kelly steht an dem Ort, an dem seine Liebe zu den Bergen begann, doch dieser Moment fühlt sich an wie ein Alptraum. Kelly hat mehr als 60 Stunden nicht geschlafen, er ist seit fast 100 Meilen auf den Beinen, ihm bleiben noch eineinhalb Stunden, um dieses verrückte Rennen als Sieger zu beenden. Falls er es ins Ziel schafft. Denn längst kann er nicht mehr unterscheiden: Ist alles nur Traum oder ist er wirklich in der letzten Runde des Barkley Marathons?
Yukon. »Du bist so ein Trottel.« Das ist der Gedanke, der Hanno Heiss durch den Kopf schwirrt, als er über das Yukon-Territorium in Kanada fliegt, und nur Wald, Seen, Flüsse und Lichter von Hütten sieht, die sich in der Einöde verirrt zu haben scheinen. Vor ihm liegt ein 725 Kilometer langer Marsch über 8.000 Höhenmeter bei bis zu minus 50 Grad. Ein Wolf wird ihn verfolgen und ein Puma, Stimmen aus der Vergangenheit und Gestalten, die eigentlich nicht da sind. Vor ihm liegt der Yukon Arctic Ultra – die Champions League unter den Ultrarennen, an Verrücktheit nicht zu übertreffen.
John Kelly und Hanno Heiss begeben sich jeweils in einen Wettkampf in der Wildnis Nordamerikas, der schnell in einen Wettkampf gegen die Wildnis umschlagen kann. Sie sind Besucher in einer Welt, in der sie nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette stehen.

Wildnis wird oft als Gegenwelt abseits menschlicher Zivilisation definiert. Laut dem Wilderness Act, den der US-Kongress zum Schutz von Wildnis erließ, ist sie ein Ort, an dem die Erde und deren Lebensgemeinschaften ungestört vom Menschen sind. Der Umwelthistoriker William Cronon bezeichnet die Wildnis als einen Ort, »an dem die Zivilisation, diese allzu menschliche Seuche, die Erde nicht ganz infiziert hat«, als den einzigen Ort, »an den wir fliehen können vor unserer Zuvielheit«. Dieser Ort hinterlässt Spuren. Kratzer an Schienbeinen etwa oder taubgefrorene Finger; doch die Wildnis geht tiefer: Sie nistet sich ein in den Kopf und bringt den Menschen an seine Grenzen – an die Begrenztheit seines Vermögens, an die Grenzen der Realität, an die Grenzen seines Selbst. Manchmal an die Grenzen seines Lebens.
Raus aus der Vollkaskogesellschaft
Tennessee. John Kelly ist 2013 seinen ersten Marathon gelaufen, zwei Jahre später schon hat er sich zum ersten Mal am Barkley Marathon versucht. Der Barkley reizt den Technischen Direktor einer Versicherung, weil er ihn herausfordert. Er ist ein Test, den kaum jemand besteht, und gleichzeitig bringt er Kelly zurück an den Ort, an dem er aufgewachsen ist. In einem Skype-Gespräch sagt er: »Ich dachte, vielleicht kann ich das schaffen.«
Der Barkley Marathon ist wie eine extreme Schnitzeljagd: Bis zu 40 Teilnehmende gibt es jedes Jahr, sie müssen Bücher finden und jeweils die Seite mit der Zahl ihrer Startnummer ausreißen, dabei legen sie 100 Meilen in den Bergen Tennessees zurück – ohne GPS, nur mit einem alten Kompass und Landkarten. Das Rennen folgt jedes Jahr einem anderen Kurs, fünf Runden lang, mal mit, mal gegen den Uhrzeigersinn. Jede Runde hat 20 Meilen und 6.000 Höhenmeter. Wer das in 60 Stunden schafft, hat gewonnen. Seit dem ersten Rennen im Jahr 1986 ist das erst 15 Läufern gelungen, noch nie einer Frau.
2017 lässt Barkley-Gründer Gary Cantrell die Läuferinnen und Läufer mitten in der Nacht um 1.42 Uhr starten. Kelly hat weniger als eine Stunde geschlafen. Im Nebel laufen die Teilnehmer los und versuchen, die Bücher zu finden, die Cantrell und seine Helfer im Frozen Head State Park verteilt haben.
Das kälteste Rennen der Welt
Yukon. Auch 3.500 Meilen nordwestlich fragen sich alljährlich viele Läufer während des Yukon Arctic Ultra, warum sie sich das antun. Hanno Heiss hat auch Jahre nach dem Rennen keine richtige Antwort darauf gefunden. Er sitzt in Südtirol in einem Büro der Bergrettung Bruneck, bei der er Mitglied ist, denkt nach und erzählt: Er ist kein typischer Läufer, hat erst während des Studiums damit angefangen. Zuerst war ihm eine halbe Stunde zu weit, später schaffte er eine Stunde, irgendwann meldet er sich beim Jungfrau-Marathon im Berner Oberland an. Er sagt: »Für andere Läufer ist das der krönende Abschluss ihrer Marathonkarriere – für mich war es der Anfang.« Irgendwann beginnt er, seine Suchmaschine herauszufordern, die immer wieder Namen von schwierigeren Rennen ausspuckt. Heiss nimmt an der Tor des Géants teil, die nicht umsonst Tour der Riesen heißt. Er bezwingt 330 Kilometer, 24.000 Höhenmeter und kommt als 56. ins Ziel. Danach ist seine Suchmaschine überfordert – bis er auf den Yukon Arctic Ultra stößt.

Der führt jedes Jahr Anfang Februar durch die kanadische Einsamkeit, von Whitehorse bis nach Dawson City. Der Yukon Arctic Ultra gilt als das kälteste und härteste Rennen der Welt. Er zieht Menschen an, die neue Erfahrungen suchen und einer Welt entfliehen wollen, in der sie müde geworden sind von den ungezählten Informationen, die täglich von Bildschirmen auf sie einflimmern und vom Komfort, an den sie sich gewöhnt haben.
»Beim Yukon Arctic Ultra kann Ihnen keiner garantieren, dass Sie irgendwo ankommen.«
Mathias Steinach, Postdoktorand am Zentrum für Weltraummedizin an der Charité in Berlin, erforscht seit Jahren, wie der menschliche Körper auf extreme Umgebungen reagiert. Mehrmals war er beim Yukon Arctic Ultra und hat mehrere Teilnehmende untersucht. Er sagt, für die meisten Läufer:innen stelle die Kälte eine neue Erfahrung dar – ebenso das Risiko. »Vieles im Leben unserer westlichen Zivilisation beruht auf Verlässlichkeit, Planbarkeit, fast wie eine Vollkaskogesellschaft. Beim Yukon Arctic Ultra kann Ihnen keiner garantieren, dass Sie irgendwo ankommen.«
Seit der Industrialisierung hat es sich der Mensch in den westlichen Industrienationen bequem gemacht in einer Welt, in der Essen und Wasser stets verfügbar sind und die Temperaturen wenig schwanken. In dieser Welt ist er sich selbst der größte Feind: Laut Weltgesundheitsorganisation sterben die meisten Menschen an sogenannten Zivilisationskrankheiten: Erkrankungen der Herzkranzgefäße oder Schlaganfällen, an Diabetes, Fettleibigkeit und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen. »Unser Körper ist immer noch der eines Jägers und Sammlers und nicht dafür gemacht, jeden Tag zehn bis zwölf Stunden an einem Computer zu sitzen«, sagt Steinach. Unser Körper kannte keinen Komfort, Jahrtausende lang war er gezwungen, mit Hitze und Kälte, mit Hunger und körperlicher Arbeit umzugehen.
Die ersten 60 Meilen – die Grenzen des Vermögens
Als Hanno Heiss am 8. Februar 2015 mit 70 anderen Läuferinnen und Läufern in Whitehorse am Start steht, zeigt das Thermometer minus 30 Grad Celsius. Wimpern und Augenbrauen tragen weiße Häubchen, an Bärten hängt Schnee. Wer hier zu schnell läuft, riskiert, sich in ein Gefängnis aus gefrorenem Schweiß zu kleiden.
Von hier sind es 430 Meilen bis zum Ziel. Heiss rechnet die Distanz in Zeiteinheiten um: rund 50 Meilen, 80 Kilometer, schafft er pro Tag. Das allein kostet viel Energie – umso mehr in der Kälte. »Der Energieumsatz unter diesen extremen Bedingungen ist um das Vier- bis Fünffache gesteigert«, sagt Matthias Steinach – und damit der Energiebedarf. Im Verlauf des Rennens können die Teilnehmer:innen bis zu acht Prozent ihres Körpergewichts verlieren.
Tennessee. 3.500 Meilen entfernt schafft John Kelly im Jahr 2017 die ersten 60 Meilen in weniger als 33 Stunden. Er beendet damit den »Fun Run« des Barkley Marathons. 40 Meilen stehen ihm noch bevor, der Kampf gegen die Müdigkeit wird Meile um Meile schwerer. Dann die letzte Runde, Kelly läuft sie im Uhrzeigersinn. 13 Stunden und 22 Minuten bleiben ihm für die letzten 20 Meilen.
Doch bald weiß Kelly, er braucht Schlaf. Er erkennt die Gegend um ihn herum nicht mehr, kann nicht zwischen Wachen und Träumen unterscheiden. Am Gipfel eines Hügels weht ein kalter Wind, Kelly weiß, dass er nach zehn, fünfzehn Minuten so sehr frieren wird, dass er aufwachen und weiterlaufen muss. Er legt sich hin. Als er weiterläuft, fühlt er sich wie ein Zombie – seine Beine bewegen sich wie von selbst. Nur wenige Meter sind es bis zur Spitze des Chimney Top, doch der Gipfel kommt nicht näher.
»Wenn du einen Fehler machst, bist du tot.« – die Grenzen des Lebens
Yukon. Am 9. Februar 2015 fällt es Hanno Heiss schwer, die warme Hütte am Dog Grave Lake zu verlassen und weiterzugehen zum nächsten Checkpoint. Je weiter er kommt, desto einsamer wird der Weg. Aber vielleicht ist er ja genau deshalb hier: Weil die Wildnis ein Ort der ultimativen Selbsterfahrung ist. Hier gibt es keine anderen Menschen, dafür umso mehr Platz für die Frage: Wer bin ich, wenn sonst niemand da ist?
 Zwei Jahre zuvor lief Heiss das Rennen schon einmal, damals gemeinsam mit einem anderen Teilnehmer. Immer wieder fragte er ihn: »Hörst du das? Gleich kommen die Guides auf den Schneemobilen.« Doch von Schneemobilen war weit und breit keine Spur. Heiss wusste, wenn er nicht ganz bei der Sache ist, kann dieses Rennen tödlich sein. Also gab er auf, 330 Meilen vor dem Ziel. Heute sagt er: »Dein Geist sollte bei diesem Rennen sein wie ein Bergsee am frühen Morgen, sonst machst du Fehler und dann bist du tot.«
Zwei Jahre zuvor lief Heiss das Rennen schon einmal, damals gemeinsam mit einem anderen Teilnehmer. Immer wieder fragte er ihn: »Hörst du das? Gleich kommen die Guides auf den Schneemobilen.« Doch von Schneemobilen war weit und breit keine Spur. Heiss wusste, wenn er nicht ganz bei der Sache ist, kann dieses Rennen tödlich sein. Also gab er auf, 330 Meilen vor dem Ziel. Heute sagt er: »Dein Geist sollte bei diesem Rennen sein wie ein Bergsee am frühen Morgen, sonst machst du Fehler und dann bist du tot.«
Nachts im Schneesturm
Der Tod, er heult durch den Wald, fegt über das Land, schleicht sich in die Gedanken. 2018 nimmt ein Schneesturm einem Läufer aus Sardinien die Sicht, Schnee durchnässt seine Schuhe, seine Handschuhe. Er zieht sie aus. Am nächsten Morgen wird er gefunden nach einer Nacht bei minus 50 Grad. Der Mann verliert beide Beine, eine Hand und einen Teil der anderen, aber er überlebt.
2015 wartet der Tod auf einem zugefrorenen See. Hanno Heiss spürt, wie es schlagartig kälter wird, als er sich dem Coghlan Lake nähert. Im Sommer zieht der See Fischer an, im Winter Temperatur-
rekorde. Minus 55 Grad. Wer sich bei diesen Temperaturen hinsetzt, wacht nicht mehr auf. Heiss ist müde, er kann seine Augen kaum öffnen, die Kälte klebt sie zu. Einen Moment lang überlegt er, seine Hand aus dem Handschuh zu nehmen, um sich Eis und Schnee aus dem Gesicht zu wischen. Heiss hat Frau und Kinder zuhause. »Doch in dem Moment habe ich akzeptiert, dass ich sterben könnte«, sagt er.
Posttraumatisches Wachstum
Menschen, die dem Tod ins Auge blicken, erzählen häufig von Wärme, Frieden und Liebe, von einem Licht am Ende des Tunnels. Und viele kehren verändert ins Leben zurück – mit neuen Werten, neuen Ansichten über den Tod. »Menschen reagieren auf einschneidende Erlebnisse potenziell mit Belastungsreaktionen, wie etwa mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Doch manchmal liegt in diesen Ereignissen auch die Chance, zu wachsen«, sagt die Psychotherapeutin Nicole Szesny-Mahlau.
Worüber sie spricht, nennt sich posttraumatisches Wachstum: Personen, die traumatische Ereignisse überlebt haben, empfinden danach häufig größeren Respekt dem Leben gegenüber, entwickeln innigere Beziehungen, fühlen sich stärker, weil sie etwas Unerwartetes geschafft haben, sie wissen besser, was sie wollen oder haben zur Spiritualität gefunden. Das Phänomen ist schwer messbar: »Wir neigen dazu, Dingen im Nachhinein einen Sinn zu geben, den sie vielleicht gar nicht haben«, sagt Szesny-Mahlau.
»Wer Momente erlebt, in denen er merkt, das Leben ist endlich, der fragt sich: Was, wenn es vorbei gewesen wäre?«
Die Psychologin und Institutsleiterin der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie Judith Mangelsdorf und ihre Kollegen Michael Eid von der Freien Universität Berlin und Maike Luhmann von der Ruhr Universität Bochum fanden 2019 in einer Meta-Analyse von 122 Studien heraus, dass viele Personen durchschnittlich eineinhalb Jahre nach einer extremen Belastung einen höheren Selbstwert und stabilere Beziehungen hatten sowie ihren Alltag besser bewältigen konnten als vor dem Ereignis. »Wer Momente erlebt, in denen er merkt, das Leben ist endlich, der fragt sich: Was, wenn es vorbei gewesen wäre? Was hätte ich bereut?«, sagt Szesny-Mahlau. »Die Sichtweise auf das Leben, wie es war, ist ins Wanken geraten. Und der Mensch beginnt, seine Prioritäten neu zu ordnen.«
Die Kälte ist nicht die einzige Gefahr im Yukon. In der zweiten Nacht des Yukon Arctic Ultra wird Hanno Heiss von einem Wolf verfolgt. Seine eigenen Spuren verschwinden in denen des Wolfs. So erzählen es ihm die Guides, die immer wieder auf Schneemobilen die Strecke abfahren und kontrollieren, wo die Teilnehmenden sind. Heiss merkt: Er ist nicht an der Spitze der Nahrungskette. Er sagt: »Wölfe hören, sehen und riechen dich. Der Einzige, der nichts sieht, bist du selbst.«
Schlaflos – die Grenzen der Realität
Tennessee. John Kelly hatte sich oft vorgestellt, wie es wäre, den Barkley Marathon zu beenden. Er wollte vom Chimney Top hinabsehen zur Farm seiner Familie, so wie er es als Kind oft gemacht hatte, er wollte hinabsehen ins Tal, in dem er aufgewachsen war. Er wollte ins Ziel laufen, das Tor berühren, an dem er gestartet war, und zum Kreis der Verrückten gehören, die dieses verrückte Rennen bezwangen.
Als er endlich oben ankommt am Chimney Top, ist es kalt und nass und so neblig, dass er kaum zwei Bäume vor sich sehen kann. Er sieht auf seine Uhr: eine Stunde und vierzig Minuten noch – dann sind die 60 Stunden um. Genug Zeit, um es ins Ziel zu schaffen. Kelly sieht noch einmal auf die Uhr: plötzlich ist es nur noch eine Stunde zwanzig. Er fragt sich: »Wie bin ich hierhergekommen? Bin ich auf dem richtigen Gipfel? Ist das überhaupt real?« Kelly hat in den vergangenen 64 Stunden nicht mehr als eine Stunde geschlafen: Der Schlafmangel lässt ihn Bekanntes in Frage stellen. Kelly sagt: »Mein Gehirn konnte nicht unterscheiden zwischen Sehen und Erinnern. Ich musste mich ein paarmal daran erinnern, dass ich wach bin.«
»Geh und berühre das Tor, John!
Berühr das Tor!«
Schlafmangel kann von Stimmungsschwankungen bis zu psychotischen Erfahrungen verschiedene Symptome hervorrufen, schreiben die australische Forscherin Flavie Waters und ihr Team in einer Studie von 2018. Sie haben verschiedene Studien ausgewertet über Schlafentzug bei Menschen, die bis zu 264 Stunden – elf Tage lang – nicht geschlafen haben. Zwischen 24 und 48 Stunden ohne Schlaf kommt es zu ersten Symptomen: Die Schlaflosen nehmen Farbe, Größe, Tiefe und Entfernung von Objekten verzerrt wahr. Sie bekommen Angstzustände, werden reizbarer, fühlen sich von sich selbst entfremdet und verlieren ihr Zeitgefühl. Nach zwei Tagen im Wachzustand beginnen sie zu halluzinieren, nach drei Tagen verfallen sie in Wahnvorstellungen. Am fünften Tag ohne Schlaf gleicht ihr Zustand dem einer akuten Psychose. 82 Prozent der Personen zeigten keine Symptome mehr, nachdem sie wieder normal geschlafen hatten.
2016 ist John Kelly in der fünften Runde vor Erschöpfung eingeschlafen. Auch im Jahr davor musste er aufgeben. Dieses Jahr will er es unbedingt schaffen. Alles, was er dafür tun muss, ist, sich an einem Gedanken festuzuhalten: »Das ist wirklich Barkley. Das ist wirklich die fünfte Runde. Du hast wirklich alle Buchseiten. Du musst nur noch das Tor berühren. Geh und berühre das Tor, John! Berühr das Tor!«
T-Rex und der Mann ohne Gesicht
Yukon. Hanno Heiss erreicht Ken Lake und läuft weiter durch das immer gleiche Farbspektrum von Grün, Blau und nicht enden wollendem Weiß. Um 16 Uhr wird es Nacht, von da an gibt es nichts außerhalb des Lichtkegels seiner Stirnlampe. Er hört die Schritte seiner monotonen Bewegungen. »Wenn du um dich herum nur Dunkelheit siehst, dann arbeitet es in dir«, sagt er.
Er denkt daran, was er zuhause jetzt tun würde, erinnert sich an eine Kassette mit Liedern aus seiner Kindheit und ärgert sich, dass er die Strophen nicht zusammenbringt. Plötzlich hört er Stimmen auf Bayrisch sprechen und auf Wienerisch. In seinem Kopf spielt sich eine Radioshow ab mit den Schauspielern Peter Alexander und Hans Moser. Die schneebeladenen Bäume verwandeln sich in T-Rex, der ihm mit dem Kopf zunickt. Auf der Gartenbank seiner Großmutter, die im Wald auftaucht, sitzt ein Mann ohne Gesicht. Ein riesiger Adler steigt auf aus goldenem Staub.
»Das Gehirn hat normalerweise jeden Tag zig Millionen Reize zu verarbeiten. Die meisten davon gelangen gar nicht in das Bewusstsein, so spürt man etwa nicht ständig die eigene Kleidung am Körper«, sagt Mathias Steinach. »Fallen diese Reize nun weg und ist die Fähigkeit zur Reizverarbeitung durch den Schlafmangel zusätzlich gestört, dann generiert das Gehirn seine eigenen Reize«: Sinnestäuschungen etwa, Pseudohalluzinationen, wie sie Hanno Heiss erlebt – er weiß, dass nicht real da ist, was er sieht – oder echte Halluzinationen, die gar nicht mehr von Realität unterschieden werden können.
Mikroschlaf
Mitten in der Nacht trifft Hanno Heiss auf Enrico Ghidoni, einen italienischen Ultraläufer, der zahlreiche Rekorde aufgestellt hat – er hat den Yukon Arctic Ultra in jeder Disziplin absolviert, dieses Jahr versucht er es mit dem Mountainbike. Auch er kämpft mit Schlafmangel und Halluzinationen, sein Rad ist kaputt, er muss es schieben. Die beiden Männer gehen gemeinsam, immer wieder halten sie an, lehnen sich auf den Lenker des Fahrrads, auf die Wanderstöcke und schlafen im Stehen. »Microsonno«, sagt Ghidoni. Mikroschlaf.
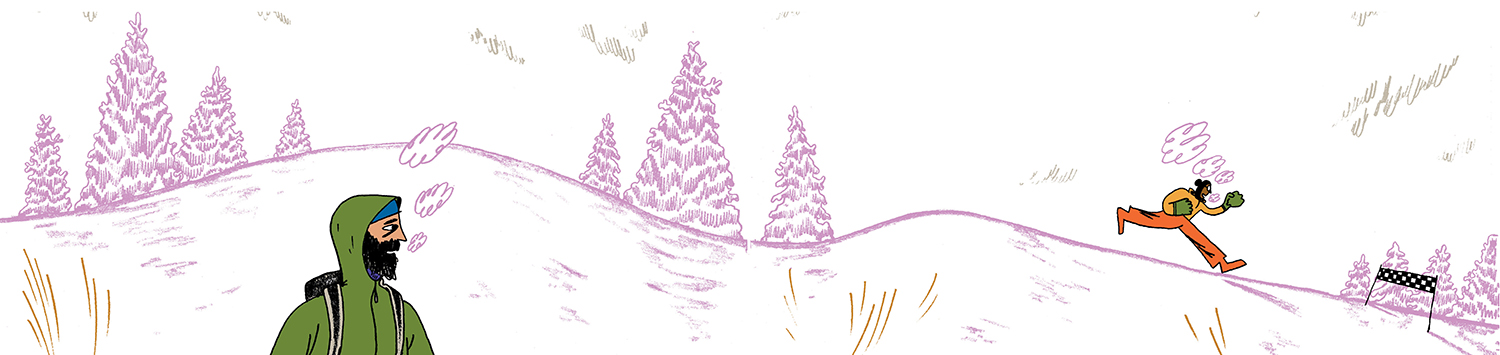
Heiss tut jeder Schritt weh, er fühlt sich, als würden Messer in seine Waden stechen. Um 6.22 Uhr morgens kommt er mit Ghidoni am Checkpoint in Carmarcks an. Heiss fragt: »Wo sind die Ersten?« Die Guides lachen: »Ihr seid die Ersten.« Die beiden haben 179 Meilen in 68 Stunden zurückgelegt. Eine Sehne in Heiss‘ Wade hat sich entzündet. Er muss einen Tag Pause einlegen. Mindestens. Von den 71 Teilnehmenden kommen 44 in Carmarcks an, die anderen geben vorher auf.
Ein anderer Mensch – die Grenzen des Selbst
Die Wildnis fordert den Menschen heraus, sie erinnert ihn daran, dass er trotz all seiner Bemühungen, sich von der Natur abzukapseln, Teil derselben bleibt. Sie wirft ihn auf sein Menschsein zurück. Der Philosoph Karl Jaspers schrieb in seiner Einführung in die Philosophie: »Ich muß sterben, ich muß leiden, ich muß kämpfen, ich bin dem Zufall unterworfen, ich verstricke mich unausweichlich in Schuld. Diese Grundsituationen unseres Daseins nennen wir Grenzsituationen. Das heißt, es sind Situationen, über die wir nicht hinaus können, die wir nicht ändern können.« In diesen Situationen stößt der Mensch an die Grenzen seines Seins, weil er sie nicht ändern, nicht umgehen kann. Und in seiner Philosophie II heißt es: »Wir werden wir selbst, indem wir in die Grenzsituationen offenen Auges eintreten (…) Grenzsituationen erfahren und Existieren ist dasselbe.«
Tennessee. Das Rennen, sagt John Kelly, liege an der Grenze zum Unmöglichen. Er habe am Barkley Marathon teilgenommen, um zu erfahren, wie weit er gehen kann. Im Ziel gibt es kein Preisgeld. Nur die Gewissheit, dass er keine sechste Runde laufen muss. In den letzten Meilen vor dem Ziel ist das mehr wert als alles andere.
John Kelly berührt das Tor um 13.12 Uhr am 3. April. Eine halbe Stunde später und er wäre bloß einer der vielen, die versucht haben, den Barkley zu bezwingen. Jetzt aber ist er der 15. Mensch, der es geschafft hat – und bisher der Letzte.
»Es ist wichtig, rauszugehen in die Natur, an unberührte Orte und den Teil tief in uns zu erreichen, dem wir sonst nicht begegnen«, sagt Kelly. »Auch wenn ich versage, gerade wenn ich versage, dann wachse ich daran.«
224 Stunden und 55 Minuten
Yukon. Nach einem Tag Pause kämpft sich Hanno Heiss weiter bis zum nächsten Checkpoint in Pelly Crossing. Von hier sind es noch 191 Meilen nach Dawson City. In der Hütte in Pelly Crossing knackt Holz im Feuer. Heiss weiß, wie es draußen aussieht: Wenn jemand die Tür öffnet, kommt Schnee herein und ein eiskalter Wind. Trotzdem humpelt er zur Tür, ein japanisches Filmteam filmt ihn dabei, er geht raus und biegt falsch ab. Es dauert eine Weile, bis er wieder auf den richtigen Weg findet. Sobald die Lichter hinter Hügeln und Bäumen verschwinden, geht mit ihnen das Gefühl von Sicherheit.
Neun Tage ist er unterwegs, als er auf den King Solomon Dome steigt. Er ist gegen Mittag dort, es ist 0 Grad warm, keine Wolke am Himmel. Er denkt: »Jetzt habe ich es geschafft, hinter der Kurve
ist das Ziel.« Dann kommen Guides auf einem Schneemobil und sagen: »Nur noch fünf Stunden.« Am 17. Februar um 19.25 Uhr läuft er als Erster seiner Kategorie in Dawson ein – er war 224 Stunden und 55 Minuten lang unterwegs. Heiss sagt, er habe sich verändert im Yukon: »Wenn du als Mensch A in die Wildnis gehst, kommst du als Mensch B zurück.«
Erschienen am 01. April 2021