Wie verändert sich Stille,
wenn Mama stirbt?
Vor zwei Jahren ist die Mutter unserer Autorin gestorben. Seitdem sucht sie häufig nach stillen Räumen, an anderen Tagen hält sie es kaum aus ohne Geräusche und Ablenkung. Eine Spurensuche nach den zwei Gesichtern der Stille – und was das mit Mama zu tun hat. Ein Essay von Anna Scheld.
Trauer
Die Dunkelheit frisst sich in meine Nachmittage, immer tiefer, gerade knabbert sie an der 16-Uhr-Grenze. Das letzte leuchtende Blatt ist vom Ast vor meinem Fenster gefallen und meine Nachbar:innen haben die LED-Blink-Lichterkette ins Fenster gehängt. Hier kommt die Weihnachtszeit, und hier kommt Mamas Todestag. Wenn man sich vormacht, dass die Welt heil ist, dann an Heiligabend.
Vor zwei Jahren ist meine Mutter gestorben. Am heiligen Abend, der stillen Nacht, dem 24.12.2021. Um 19 Uhr 19 hat sie aufgehört zu atmen, in einem Krankenbett mitten in der Wohnküche, meine zwei Brüder, mein Vater und ich saßen um sie herum. So viel zum Ende. Begonnen hat es mit dem Schweigen meiner Mutter, darüber, dass sie schlecht schlucken kann, dass sie sich übergeben muss und nicht weiß, warum. Sie wusste, dass sie Krebs hat, aber hat es uns einige Tage lang nicht erzählt, hat es in sich hinein geschwiegen, war still. So viel zum Anfang.
Seit dem Tod meiner Mutter habe ich eine Hassliebe zu Stille entwickelt. Ich sehne mich nach ihr, Menschen und Geräusche halte ich manchmal nicht lange aus. Ich will mich in der Stille verstecken und in ihr verkriechen, fühle mich in ihr wohl. Draußen sind mir mal wieder zu viele Gesichter entgegengekommen und Autos an mir vorbei gefahren – obwohl ich nur kurz einkaufen war. Erleichtert drehe ich den Schlüssel meiner Wohnungstür.
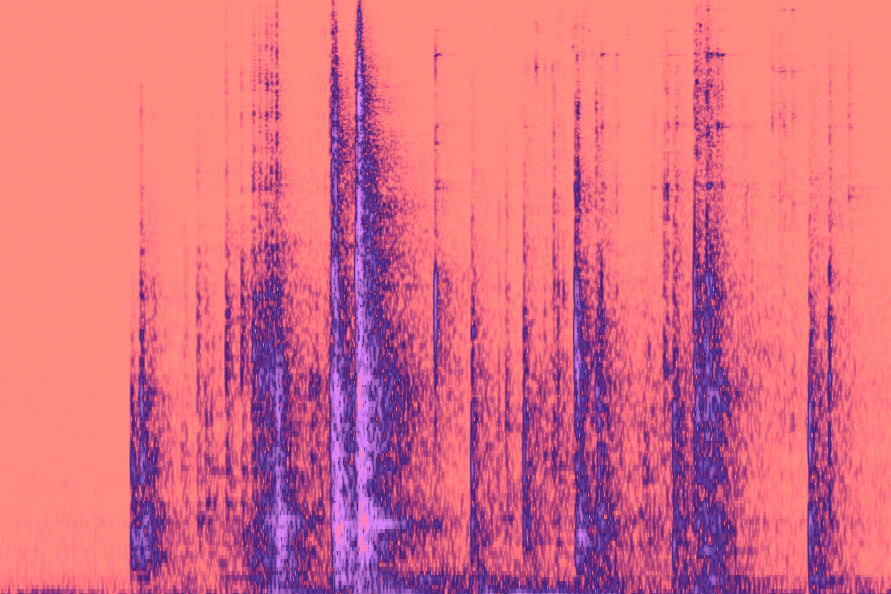
Gleichzeitig kann ich Stille nicht richtig zulassen. Ich war noch nie allein am Grab meiner Mutter. Vor Mamas Stein schweigen statt mit Mama reden, wie soll das gehen? Zwei Wochen nach ihrem Tod habe ich eine anstrengende Ausbildung angefangen. Eine Zeit voller Menschen und Lernen und Denken, das alles hat jeden Tag in meinem Inneren nachgehallt, hat anderes, Leiseres übertönt. Fünf Monate nach ihrem Tod habe ich eine Beziehung mit einem Mitschüler angefangen. Wir haben regelmäßig stundenlang über seine Anlage Musik gehört. Unbekannte Klänge, neue Melodien. Nur ab und zu, wenn ich es eingefordert habe, war ich allein.
Ich habe die kollektive Stille an Heiligabend immer geliebt. Jetzt ist da auch Angst. Weil bei uns zu Hause jetzt Stille ist, wo früher Klänge waren. Nach dem Essen in der Küche ist Mama in ihrem roten Kleid rüber ins Wohnzimmer, zum Weihnachtsbaum und den Geschenken. Sie hatte schon alles vorbereitet: Den großen Teller mit Plätzchen bereitgestellt, alle Geschenke unter den Baum gelegt. Jetzt kamen ihre letzten Handgriffe: Kerzen anzünden, das Weihnachtsoratorium von Bach auflegen und mit einem Glöckchen klingeln. Das war das Zeichen, wir durften dazukommen. Letztes Jahr, am ersten Weihnachten ohne Mama, hat mein kleiner Bruder mit dem Glöckchen geklingelt. Ich habe versucht, das Gewicht auf meiner Brust und die Enge in meinem Hals mit tiefen Zügen irgendwie wegzuatmen.
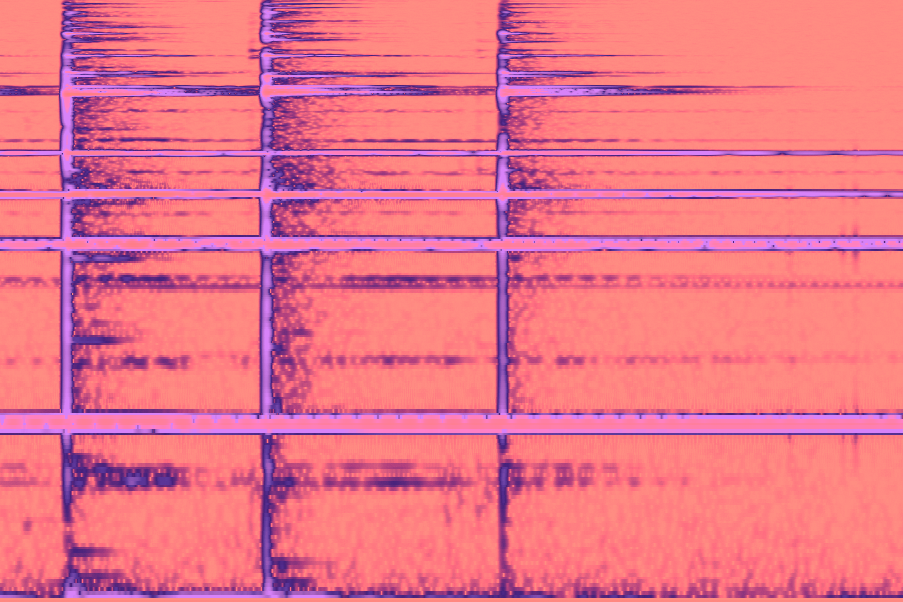
Stille Nacht. Dieser Tag ist beides: behaglich und schrecklich. Wie kann ich das vereinen? Warum sehne ich mich so oft nach Stille, und warum wirkt sie an anderen Tagen so bedrohlich? Vielleicht hilft es mir, wenn ich die Stille erkunde. Als Geräusch, als Zustand, als Gefühl, als Charaktereigenschaft.
In den ersten Tagen der Ausbildung waren die elf anderen aus meiner Klasse jeden Abend in einer Kneipe, sie haben sich über ihre Biere und den Kneipenlärm hinweg kennengelernt. Ich saß nicht bei ihnen. Ich saß in meinem neuen Zimmer, habe Kerzen angezündet, die Vorhänge zugezogen und stundenlang gelesen. Mir ist es immer wichtig gewesen, was andere von mir denken. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie mich komisch finden. Damals konnte ich trotzdem nicht anders. Mir war alles zu laut. Kein anderer Mensch im Raum. Keine lauten Geräusche. Kein Bildschirm. Wenig Licht. Stille als Überlebensmodus.
Der Duden definiert Stille als »durch kein lärmendes, unangenehmes Geräusch gestörter wohltuender Zustand«. Aber Stille ist mehr als das. Mein Vater hat meiner Mutter zu ihrem letzten Weihnachten 2021 ein Buch gekauft, dass er ihr dann nicht mehr schenken konnte. Es heißt Stille für Frauen. Als ich Papa erzähle, dass ich einen Artikel über Stille schreibe, kramt er das Buch hervor und gibt es mir.
Die Autorin Luitgard Jany hat in diesem Buch hunderte Frauen gefragt, was Stille für sie bedeutet. Sie beschreibt, dass die meisten Frauen überrascht auf die Frage reagierten. Die Antworten waren extrem unterschiedlich: Innere Ruhe, Glück, Geborgenheit, Einsamkeit, Trauer, Luxus, Angst, Meditieren. Stille ist also nicht nur für mich ambivalent – jeder Mensch erlebt sie anders.
Tage später schreibe ich meinem Vater über WhatsApp: »Papa, warum hast du Mama eigentlich das Buch über Stille gekauft?« Er schreibt: »Weil sie Stille sehr mochte.« Stimmt. Mama hat die Stille des Morgens geliebt. Wenn ich zu Besuch war und um acht oder neun Uhr zum Guten-Morgen-Sagen in ihr Zimmer kam, saß sie schon seit Stunden auf ihrem Sofa. Sie schrieb Tagebuch, las, oder beobachtete die Spatzen auf ihrem Balkon, neben sich eine leergetrunkene Teekanne. Oft war sie genervt von Papas Radio, das durch den langen Flur bis zu ihr in die Wohnküche schallte. Mama hat das Geräusch in den Wahnsinn getrieben. Papa lässt das Radio noch heute auf Dauerschleife laufen, weil es ihn beruhigt. Warum sehnen sich manche nach Stille und andere nicht?
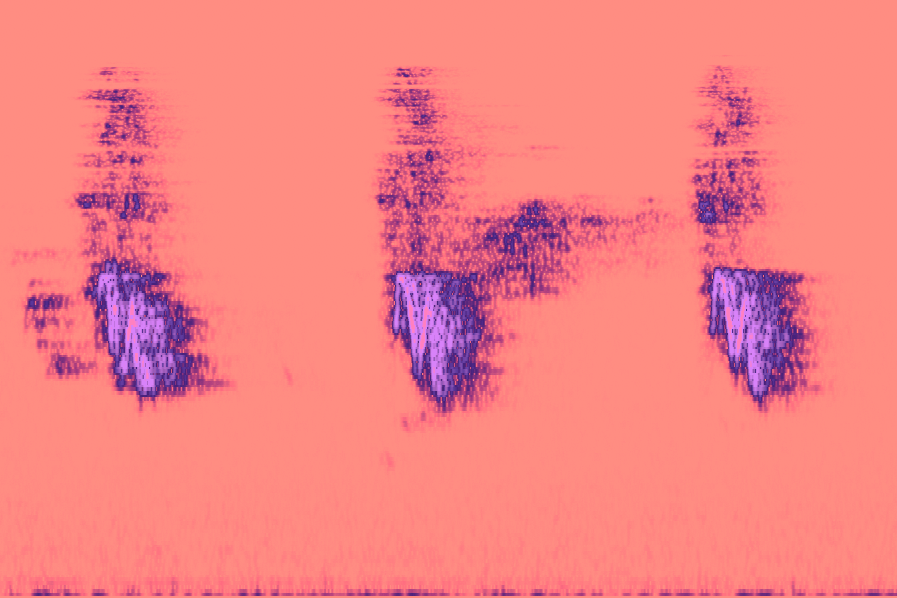
Ein paar Wochen nach dem Anfang meiner Ausbildung war meine Hyperempfindlichkeit nicht mehr so schlimm. Meine Mitschüler:innen und ich näherten uns an, kochten zusammen, gingen spazieren, wurden Freund:innen. Und dann passierte es: Ich hielt Stille nicht mehr aus. Hörte Musik oder Podcasts, wenn ich zu Hause war. Ging abends mit auf ein Bier, fuhr mit nach München zum Feiern. Knutschte mit einem Mitschüler. Ich brauchte Stille nicht mehr zum Überleben. Und so ging sie mir verloren.
Seitdem habe ich das Gefühl, nicht »richtig« zu trauern. Ich bin ab und zu mal sehr traurig, aber ansonsten leide ich nicht so, wie ich dachte, dass es Trauernde tun. Meine Mama war der wichtigste Mensch in meinem Leben. Wir haben uns stundenlang unterhalten, haben uns am Ende dieser Gespräche beide voller Energie gefühlt, sind jede Wendung im Gedankengang der anderen mitgegangen und haben uns verstanden gefühlt. Jetzt habe ich das Gefühl, ich denke nicht oft genug an sie. Manchmal ist sie mir gar nicht richtig präsent. Ich habe Angst, dass ich die schlimme Trauer verdränge, dass sie irgendwo unter der flauschigen Decke des Alltags schlummert. Mache ich etwas falsch? Gibt es eine richtige, eine bessere Trauer? Wie bekomme ich Zugriff auf dieses Gefühl?
Das bekannteste Trauermodell kommt von der amerikanisch-schweizerischen Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross. Fünf Phasen der Trauer benennt sie, und ich finde mich in keiner davon richtig wieder. Nicht-Wahrhaben-Wollen, Zorn, Verhandeln, Depressionen, Zustimmung. Das wirkt zu starr und akademisch.
Die Psychologin Hildegard Willmann aus dem Schwarzwald schreibt einen Newsletter, der sich mit den neuesten Erkenntnissen der Trauerforschung befasst. Ich frage sie in einer Mail, ob sie mit mir telefonieren möchte.
Sie schreibt sofort zurück: Ja, wir telefonieren später. Dann schreibt sie mir vorab ein, wie sie es nennt, »Amuse-Gueule« per Mail. Darin steht: »Dass Menschen dauerhaft ihre Trauer verdrängen ist sehr, sehr selten. Meist es ist so, dass Trauernde und ihr Umfeld die Erwartung haben, dass es mehr Leid und Tränen braucht, als die Trauernde empfindet. Aber Trauer kann auch sehr mild verlaufen. Verarbeitungsstile können sehr unterschiedlich sein.«
Schon bei dieser Antwort spüre ich, wie sich in meinen Schultern eine Anspannung löst, der ich mir vorher gar nicht bewusst war. Eine Leichtigkeit breitet sich aus, wo vorher eine leise Schuld gewesen ist. »Trauer kann sehr mild verlaufen«. Das habe ich noch nie gehört, ich fühle mich von Willmann gesehen.
Am Telefon sagt sie sofort, dass sie nichts hält von den Trauerphasen von Kübler-Ross. »Das sollte schnell in der Mottenkiste der Geschichte verschwinden. Das ist empirisch nicht nachweisbar.«
Ich erzähle ihr ein wenig von mir und meiner Angst vor der Stille und frage, ob sie glaubt, dass ich meine Trauer verdränge. »Ich kenne Sie ja nicht«, sagt Willmann, »aber es hört sich für mich nicht so an, als würden Sie aktiv die Trauer verdrängen.« Ich erzähle ihr vom Vorabend: Ich war allein zu Hause, mein Freund ist gerade im Ausland. Ich habe ein komisches Unbehagen gefühlt, Stille hat mir Angst gemacht. Und irgendwie habe ich in solchen Momenten Angst vor meiner Traurigkeit.
Bedingt sich das: Stille und Traurigkeit?
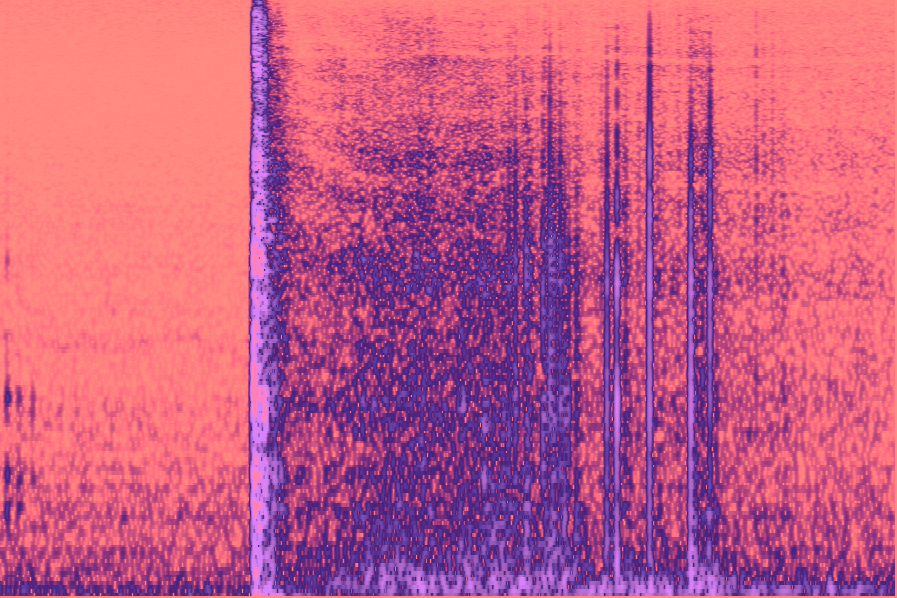
Willmann sagt, Stille könne helfen, Trauer und Traurigkeit besser zuzulassen. Für manche funktioniere das gut: sich bewusst eine Kerze anzünden, ein Fotoalbum durchblättern und die Tränen laufen lassen. Aber wenn ich mich von Stille bedroht fühle, sagt sie, dann solle ich mich besser ablenken. Das sei völlig in Ordnung und habe nichts mit Verdrängen zu tun. Trauern, sagt sie noch, seien nicht immer nur negative Gefühle. Trauern könne auch sein, oft von der Person zu sprechen. Oft an sie zu denken. Mich mit ihr auseinanderzusetzen.
Vor ein paar Wochen bin ich umgezogen. Mein Freund – derjenige, den ich in der Ausbildung kennengelernt habe – und ich sind aus einer klitzekleinen Zwischenmiete am Ostkreuz – einem Szene-Hotspot mitten in Berlin – umgezogen nach Charlottenburg, einem ruhigen Bezirk. Die Wohnung gehört einer Freundin meiner Mutter. Wir zahlen wenig Miete. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist: Die Wohnung liegt genau gegenüber der Wohnung meiner Eltern. Jede Straße flüstert mir Erinnerungen zu, und weil es so viele Schichten an Erinnerungen sind, wird das vielfache Flüstern manchmal zum lauten Stimmengewirr und erdrückt mich. Dort drüben, ich sehe es aus meinem Fenster, ist das Zimmer, in dem meine Mutter gestorben ist. Wären die Jalousien nicht gewesen, hätte man uns damals von hier aus beim Sterben zugucken können.
Am Tag des Umzugs sitze ich mit meinem Freund im Auto, eben haben wir noch ein paar letzte Kisten aus der alten Wohnung geholt. Er hat gerade eingeparkt. Wir bleiben noch kurz sitzen, er sortiert irgendwelche Kabel. Ich sage nichts, schaue nur aus dieser kleinen Auto-Höhle auf meine alten Straßen. Jeder einzelne Straßenname erinnert mich an Mama. Erinnern, das Wort ist zu schwach – jeder Straßenname ist Mama. Jedes Haus, jede Birke am Straßenrand ist Mama. Ich bin in diesem Kiez geboren. Das Auto, in dem ich sitze, steht nur eine Straße entfernt von meinem Kindergarten. Gegenüber vom Kindergarten ist die Kirche, in der wir die Trauerfeier für Mama abgehalten haben. Das Glockenläuten werde ich in der neuen Wohnung jeden Sonntag hören.
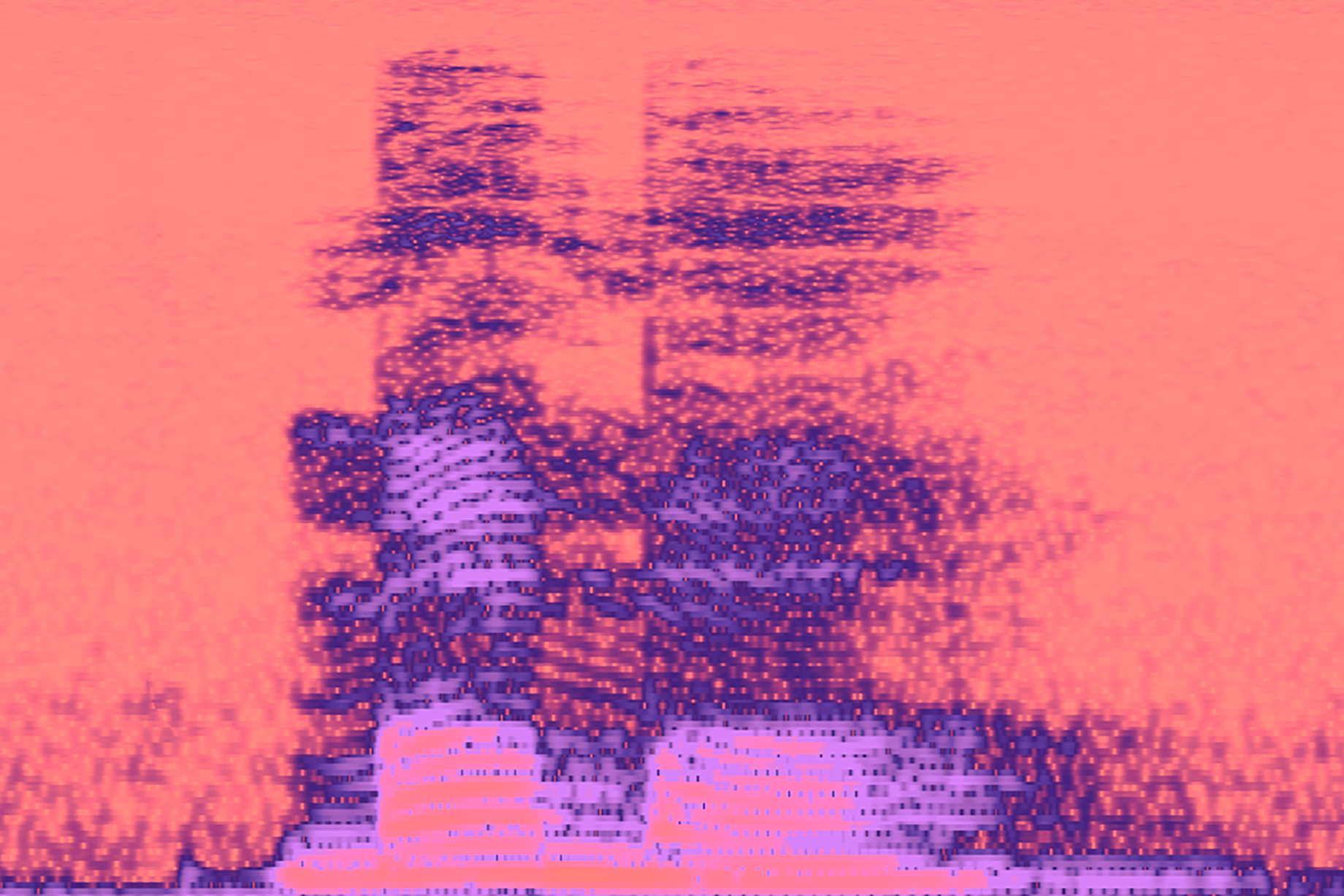
Meine Trauer verdrängen? Das habe ich geglaubt. Aber hier ist das doch gar nicht möglich. Eher könnte es ins Gegenteil kippen: Hier kann ich dem Gedanken an Mama und an das, was passiert ist, nicht mehr entkommen.
Stimme der Mutter
Ich weiß noch, wie ich einmal meinen Vater angerufen habe. Es war ein Abend während der Ausbildung. Ich habe ihn übers Festnetz angerufen. Ausgerechnet. Nach vier Mal Tuten kam der Anrufbeantworter. Ich drückte mehrmals erschrocken den roten Button für Auflegen. Der Anrufbeantworter hatte die Stimme meiner Mutter abgespielt. Seitdem rufe ich meinen Vater nicht mehr auf dem Festnetz an. Ich weiche der Stimme meiner Mutter aus wie einem Geist. Ich habe bestimmt hundert Sprachnachrichten meiner Mutter und habe sie seit ihrem Tod nicht mehr angehört. Ich glaube, ich halte das nicht aus: zu hören, wie ihre Stimme in die Stille ihres eigenen Todes hineinspricht.
Später frage ich mich: Was macht das eigentlich mit einem Menschen, die Stimme seiner Mutter zu hören? Klingt die für uns irgendwie anders als andere Stimmen? Kann ich lernen, die Stimme wieder als etwas Beruhigendes zu empfinden – und nicht als Geist?
Babys reagieren auf die Stimme ihrer Eltern, ihrer Mutter, die sie schon im Bauch hören. In einer Studie der Zeitschrift Scientific Reports aus dem Jahr 2021 fanden Forschende heraus, dass der Schmerz von Neugeborenen durch die Stimme ihrer Mutter gelindert wird. Eine Studie in der Zeitschrift Proceedings of the Royal Society B kam 2010 zu dem Ergebnis, dass die Stimme der Mutter eine beruhigende Wirkung auf ihre Töchter hat. Die Mädchen sollten vorher vor einem fremden Publikum sprechen und Rechenaufgaben lösen. Als sie ihre Mutter danach anriefen, sank der Cortisolwert, der Oxytocinwert stieg, und das sorgte für ein Gefühl von Geborgenheit und Bindung zur Mutter.
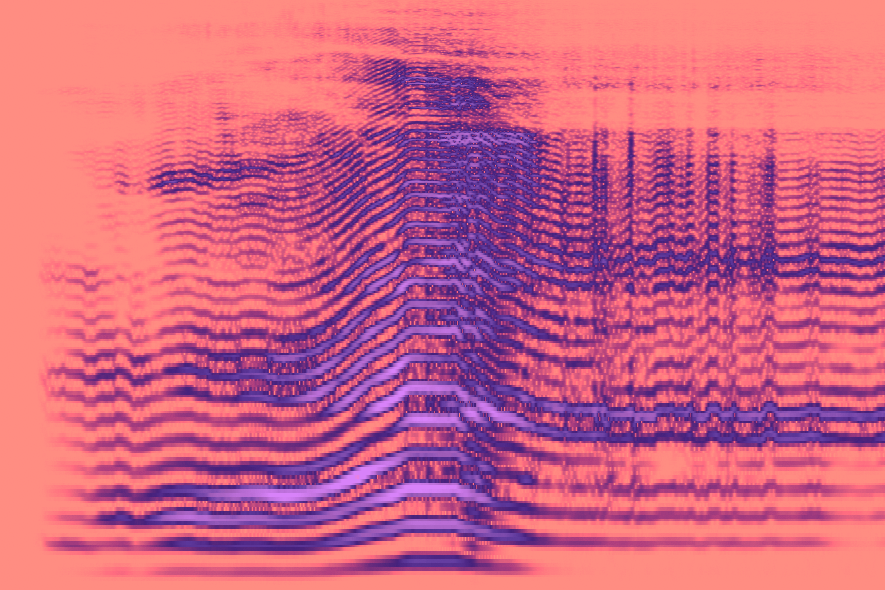
Schöne Ergebnisse, aber alle untersuchen die Wirkung der Mutterstimme auf Kinder. Zu Erwachsenen und der Stimme ihrer Mutter finde ich nichts. Wie ist das mit der Stimme meiner Mutter: Kann meine Mutter mir noch Trost schenken, also wirklich körperlich, wenn ich mich überwinde und ihre Sprachnachrichten anhöre? Ich bin zu feige, es einfach auszuprobieren, erst möchte ich hören, was die Wissenschaft sagt.
Ich frage einen renommierten Psychoakustiker: Jürgen Hellbrück hat sogar ein Buch über das Hören geschrieben. Seine Antwort: Er könne sich durchaus vorstellen, dass die Stimme meiner Mutter auf mich eine »ähnliche, wenn auch abgeschwächte Wirkung« haben könne, wie es die Studien beschreiben. Stimmen können sich, genau wie Erinnerungen und Vorstellungen, auf die »psychophysische Verfassung« auswirken.
Eigentlich klar. Die Sprachnachrichten könnten dieses vertraute Mama-Gefühl ins Heute holen. Dafür bin ich noch nicht bereit. Zumindest jetzt noch nicht.
Meditation
In der Zeit, als meine Mama im Sterben lag, habe ich eine Art Meditation für mich erfunden. In meinem Zimmer in der Wohnung meiner Eltern habe ich erst eine kleine Yoga-Session gemacht, auf Mamas grüner Yoga-Matte. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, habe die Hände auf den Bauch gelegt, habe langsam geatmet. Und habe mir vorgestellt, ich hätte eine Art Kern, wie eine Frucht, der mich als Lebewesen ausmacht, und der unberührt von allen schlimmen Emotionen bleibt und in dem sich alles leicht und schwebend anfühlt. Ich habe das in dem Moment auch gespürt. Ich wurde ruhig und leicht. Das hielt nicht ewig an, aber obwohl ich nicht wusste, ob Mama noch lebt, wenn ich aufwache, habe ich fast jede Nacht durchgeschlafen. So habe ich mir das zurechtgelegt, eine intuitive Stille.
Knapp zwei Jahre später ist all die intuitive Weisheit verschwunden. Ich habe mich oft reingesteigert in Stress, Angst und Sorgen. Vor allem wegen meinem Beruf und meinem sozialen Umfeld. Ich habe nur manchmal geschafft, davon innerlich wieder Abstand zu nehmen.
In den Zeiten, in denen akute Panik und Sorge um meine Mama besonders laut waren, hat mir Yoga geholfen, habe ich mir eine eigene Meditation ausgedacht, ohne zu wissen, was Meditation wirklich ist. Ich habe es nur so genannt. Und es hat mir geholfen. Jetzt möchte ich es genauer wissen. Ich möchte wieder Kraft aus meiner inneren Stille schöpfen. Und vielleicht finde ich dort, in der Verbindung mit mir, ja auch einen Weg zu meiner ganz persönlichen Trauer.
Meditation ist für mich der Inbegriff von Stille. Bis ich im Buch von Luitgard Jany eine Stelle finde, in der sie Meditation eine »nahe Verwandte der Stille« nennt. Das finde ich schön. Aber was ist Meditation nun wirklich, und was macht sie mit meinem Körper, meiner Psyche?
Ich rufe Janika Epe an, die Psychologin arbeitet auch als Yoga-Lehrerin und forscht zur Wirkung von Meditation. Epe erklärt mir, dass im Alltag der meisten Menschen der Sympathikus aktiviert ist, also der Teil des vegetativen Nervensystems, der für Leistung und Aktivität zuständig ist und daher auch bei Stress aktiviert wird. Ein anderer Teil des Nervensystems wird dadurch oft verdrängt: Der Parasympathikus, verantwortlich für Entspannung und Ruhe. Meditation, Atemübungen und Yoga bringen die beiden in Balance. Das kann man trainieren.
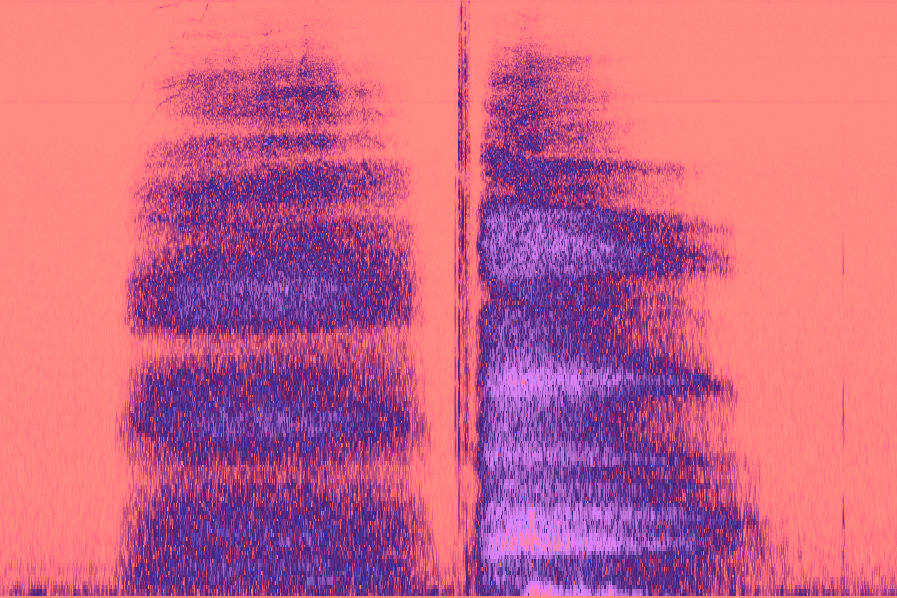
Und das, sagt Epe, erreichen wir nicht nur im Lotussitz. Das ist das gängige Bild, das uns in den Kopf kommt, wenn wir an Meditation denken. Epe ist der Auffassung, Meditation ist viel niedrigschwelliger. Meditation kann auch bedeuten, »bewusst zu betrachten«, also die ganze Aufmerksamkeit auf ein Objekt oder einen inneren Zustand zu lenken. Sie erwähnt als Beispiel Nonnen oder Mönche im Kloster, die zwar arbeiten, also nicht nur still sitzen, aber in einem Zustand der Meditation. Also der inneren Einkehr. Es gibt zum Beispiel auch Gehmeditation.
Da fällt mir auf: Das mache ich ja schon. Und zwar oft. Wenn ich ohne Kopfhörer spaziere und auf die Umwelt höre. Oder wenn ich meine vielen Zimmerpflanzen mit Wasser besprühe und sehe, wie sie sich entwickeln. Wenn ich ganz darin versunken bin – dann ist das eine Form von Meditation. Eine Form von innerer Stille.
Als ich kurz nach dem Umzug meinen Papa abends besuche, schaue ich auch im Zimmer meiner Mutter vorbei. Wir haben alles genau so gelassen, wie es war. Jeder ihrer Gegenstände spricht zu mir. Die Bilder an der Wand erzählen mir von Mama, das Chaos auf ihrem Schreibtisch und die Bücher im überquellenden Regal. Ich will die Stille ihres Zimmers nicht durcheinanderbringen. Auf ihrer Kommode steht immer noch ein kleiner Holzbuddha, den ich ihr vor zehn Jahren aus Bali mitgebracht habe. In einer Art Testament, das sie geschrieben hat, steht, dass ich ihn mit zu mir nehmen soll. Bis jetzt habe ich mich das nicht getraut.
Als ich ihn da so stehen sehe, frage ich mich: Kann mich Meditation meiner Mama näher bringen? Ich könnte mir den Buddha nehmen, ihn fokussieren und betrachten. Buddha, die Figur steht ja für genau das: Meditation. Und er ist ein Gegenstand, der meiner Mama viel bedeutet hat. Den sie mit mir verbunden hat. Ich stehe noch im Türrahmen und überlege all das, da fällt mir ein, was Janika Epe noch gesagt hat: Meditation funktioniert nur, wenn man damit nichts erreichen will. Das gilt für Manager:innen, die mit 20 Minuten Meditation am Tag den Umsatz ihres Unternehmens steigern wollen. Aber das gilt auch für mich, wenn ich mir vornehme, meiner Mutter durch Meditation näher zu kommen, und so eine bessere Trauernde zu werden.
Geräusche
Ich bin in meiner Trauerzeit lärmempfindlicher geworden. Kurz nach dem Tod meiner Mutter habe ich Stille gebraucht, um nicht verrückt zu werden. Aber auch heute noch bin ich häufiger geräuschempfindlich als zuvor. Die Weltgesundheitsorganisation schreibt: Lärmbelästigung verursacht körperliches und seelisches Leid.
Ich lese ein Interview mit dem Psychoakustiker Alfred Zeitler auf einer Hochschulwebsite. Zeitler sagt darin: »Das Hören ist das Tor zur Seele.« Wie poetisch. Da werde ich neugierig – und vereinbare ein Telefonat mit ihm. Er erläutert mir seinen Satz: »In unserer Gesellschaft legen wir viel zu wenig Wert darauf, uns vor Lärm zu schützen. Wir lassen bedenkenlos alles durchs Ohr und sind uns oft nicht bewusst, wie schädlich sich das nicht nur auf unser Hörorgan, sondern auch auf die Seele auswirken kann.« Wenn man beispielsweise eine neue Wohnung kaufe, wer achte da schon auf Hellhörigkeit? Wichtig seien vor allem Lage, Licht und Aussehen.
Ich erzähle ihm davon, dass ich immer wieder geräuschempfindlich bin, vor allem kurz nach dem Tod meiner Mutter. Dazu sagt er: »Ja, in bestimmten Phasen erhöhter psychischer Belastung neigt man zu erhöhter Lärmempfindlichkeit. Menschen unterscheiden sich aber auch allgemein in diesem Merkmal, es kann auch eine Charaktereigenschaft sein.«
Alleinsamkeit
Ich lasse den Buddha erstmal in Mamas Zimmer stehen und gehe in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen. Als ich ins offene Regal greife, kommt eine Erinnerung hoch. Mama hat öfters kleine, abgeknickte Blumen unterwegs aufgesammelt. Sie hatte Mini-Vasen, in die sie die Blumen gesteckt hat – und hat sie dann an unscheinbare Alltagsorte gestellt. Wie zum Beispiel das Regal mit den Wassergläsern. Als ich ihr einmal gesagt habe, dass ich das schön finde, hat sie sich gefreut. Darüber, dass ich etwas so Kleines, Stilles sehe, das für viele andere unsichtbar ist. Meine Mama hatte eine reiche innere Welt, und davon war ihre Wohnung eine Erweiterung. Überall Postkarten, Figürchen, Keramik, gerahmte Bilder, für sie alles summend von Bedeutung. Überall kleine Zeichen, die nur sie verstand.
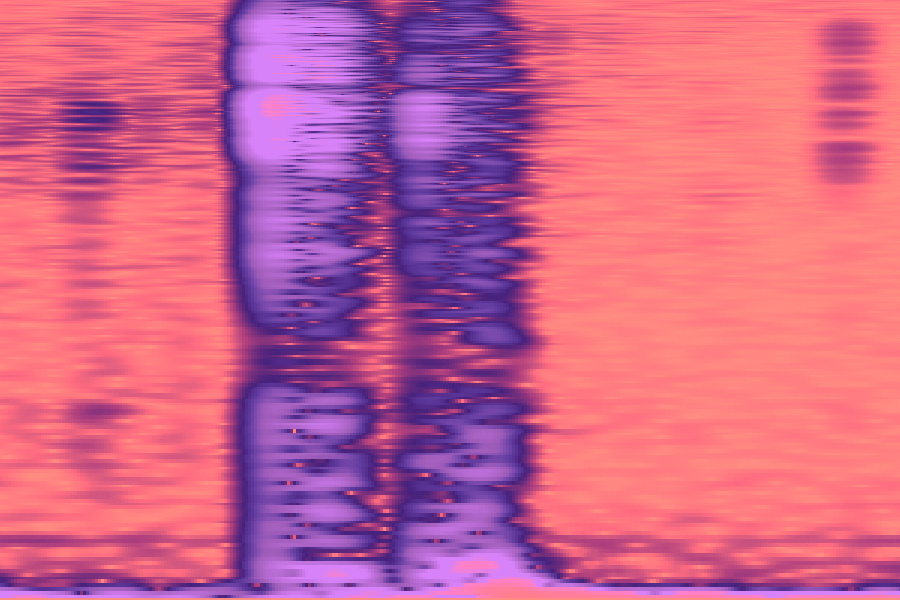
Meine Mutter hat Stille gemocht. Wenn das Bedürfnis nach Stille etwas mit dem Charakter zu tun hat, habe ich das vielleicht von ihr geerbt. Lange habe ich nicht verstanden, dass das der Zustand ist, aus dem ich am meisten Energie schöpfe: Alleinsein, in meiner eigenen Stille. Ich dachte die meiste Zeit meines Lebens, Stille ist nichts wert. Und ich bin nichts wert, wenn ich still bin. Mein Bedürfnis bekam von mir deshalb keinen Raum, es hatte keine Daseinsberechtigung.
Also habe ich mir angeeignet, in Gesprächen nie zu schweigen, bin ins Gegenteil gegangen: Ich wurde zur Königin des Smalltalks. Habe viel gefeiert, in Clubs und auf Partys, habe viel Zeit in großen Gruppen verbracht. Obwohl ich oft einfach nur allein sein wollte oder lieber ein Gespräch zu zweit gehabt hätte.
Ich tippe ins Suchfeld des Duden: introvertiert. Er zeigt mir Synonyme an: verschlossen, distanziert, zugeknöpft. Dann gebe ich extrovertiert ein, da kommen: kontaktfreudig, weltoffen, kommunikationsfähig. Wie viele Menschen glauben, dass ein Leben nur wertvoll sein kann, wenn es auch sichtbar und hörbar ist? Die eigene Stimme finden, laut sein, nur so ist man erfolgreich. Beweis: Social Media.
Ich bin gerne unter Leuten, kann gut quatschen, führe oft das Gespräch. Bin sehr offen. Trotzdem bin ich oft auch gerne allein und spreche mit niemandem. Wie geht das zusammen?
Auf meiner Suche nach Antworten finde ich die Free-Trait-Theory von Brian Little. Sie besagt, dass wir uns entgegen unserem Bedürfnis nach Alleinsein verhalten, wenn wir damit wichtige persönliche Anliegen erreichen wollen. Genau das habe ich immer getan: Mich entgegen meiner Natur verhalten. Mein Hauptanliegen, wenn ich es herunterbreche, war: Mich nicht wertlos fühlen. Wenn ein Mensch still ist, verwechseln viele das damit, dass er nichts zu erzählen hat. Stille ist manchmal ein falscher Freund. Sie sieht aus, als hätte man nichts zu sagen. Doch das Gegenteil ist oft der Fall: Da sind viele, viele, vieeeeele Gedanken, die nur nicht immer ausgesprochen werden.
Deshalb verhandle ich meine Grenzen immer wieder, auch heute noch. Ich frage mich: Wie verhandelbar ist mein Bedürfnis nach Stille? Mein Freund möchte am liebsten jeden Abend mit mir verbringen. Ich möchte gerne mal Abende allein haben. Meine Freund:innen fragen, ob ich am Freitagabend mit feiern gehe. »Ja«, sage ich, und »nein, ich möchte viel lieber mit euch kochen und einen Film schauen« denke ich. Und dann kommt noch die Arbeit: Als Journalistin ist es mein Job, Leute zu nerven. Zumindest manchmal. Sie auf der Straße ansprechen, nicht locker lassen, sie überzeugen, mit mir zu reden.
Auch hier hilft mir etwas, das Brian Little Regenerationsnische nennt: Es ist okay, im Namen meiner Herzensangelegenheiten oder Herzensmenschen gegen mein Bedürfnis nach Stille zu handeln. Aber ich kann mir Regenerationsnischen erschaffen. Das sind Räume, in die ich mich zurückziehen kann. Physisch oder gedanklich.
Mir das bewusst zu machen, macht es vielleicht auch mal leichter, Grenzen zu überschreiten. Das ist okay, so lange ich mich regelmäßig zurückziehen kann.
Gleichzeitig gibt mir die Theorie Mut, mich wichtiger zu nehmen. Ehrlich sagen, wenn ich allein sein will, auch wenn ich das dritte Mal in Folge eine Feier absage.
Dabei hilft mir auch eine Erkenntnis, die schon meine Mama für sich entdeckt hat: Die innere Welt ist reich, und manchmal ist sie wichtiger als die äußere. Mamas innere Welt war so groß, dass die äußere manchmal zu kurz kam. Das möchte ich auf keinen Fall. Ich will mich der äußeren Welt auch hingeben.
Seneca schreibt in seinem Traktat Über die Wut, das auf der stoischen Philosophie aufbaut, den Satz: »Nichts ist groß, was nicht zugleich auch still ist«.
Stille ist viel mehr als die Abwesenheit von Lärm. Sie ist eher etwas in uns Menschen. Ein Zustand, ein Gefühl. Sie ist für jeden von uns etwas Persönliches, schreibt die Autorin Luitgard Jany. Die Psychologin Janika Epe hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Meditation etwas ist, was ich oft tue – ohne es zu merken. So kultiviere ich meine ganz eigene Stille. In Zukunft möchte ich mehr auf mein Bedürfnis hören, Stille. Und gleichzeitig auch mal Kompromissen den Raum geben, den sie brauchen. Das Leben ist nun mal oft laut.
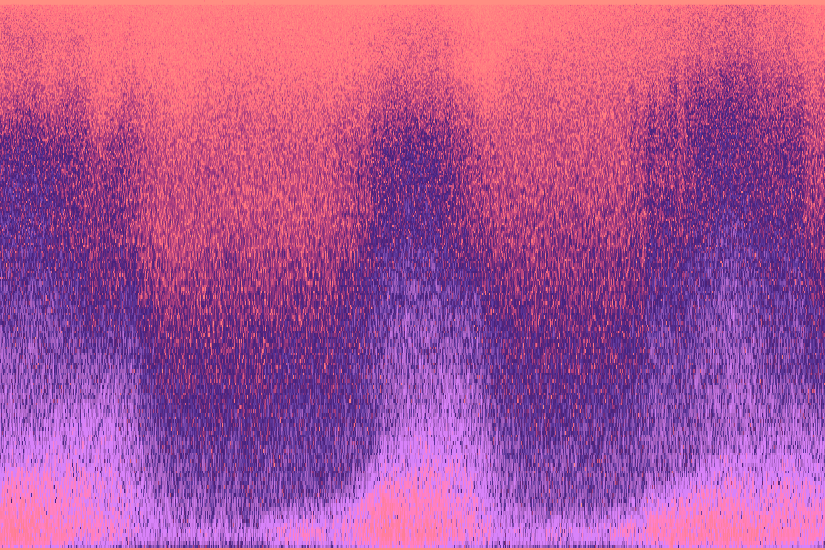
In dem Buch Stille des Norwegischen Bergsteigers Erling Kagge ist ein Mail-Austausch mit dem norwegischen Poeten und heutigen Literaturnobelpreisträger Jon Fosse abgedruckt. Ihr Thema: Stille. Fosse schreibt: »Stille trägt auch eine Art Macht in sich, ja, wie ein Meer oder eine endlose Schneelandschaft. Und derjenige, der nicht über diese Macht staunt, fürchtet sich vor ihr. Und das ist wohl der Grund, warum so viele vor der Stille Angst haben.«
Über Stille staunen und zugleich vor ihr Angst haben, vielleicht ist das gar kein Entweder-Oder. Vielleicht dürfen die beiden Gefühle nebeneinander existieren.
Und vielleicht darf ich mich meiner Mama manchmal nah fühlen und manchmal fern. Mit der leisen Sicherheit, dass sie dort auf mich wartet, geduldig, immer wieder – in der Stille.
Erschienen am 15. Dezember 2023.