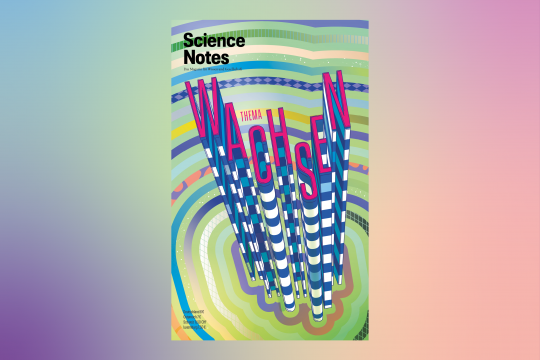Bin ich ein Jammerlappen?
Unsere Autorin hat sich immer als Optimistin gefeiert. Doch mittlerweile hört sie häufiger, sie sei eine Jammerliese. Dadurch fragt sie sich, warum wir eigentlich jammern – und stößt dabei auf die Frage nach ihrem Platz in dieser Welt. Ein Essay von Nelly Ritz.
Es gibt kaum ein Kinderfoto von mir, auf dem ich meinen Mund nicht übertrieben in die Breite ziehe – als gelte die Regel: Wer am meisten Zähne zeigt, ist am glücklichsten. Auch später – in der Schule, beim Ferienjob, in Praktika – hörte ich oft, ich hätte eine so positive Art. Ich habe mir selten von Regenwetter oder verspäteten Bussen die Stimmung verderben lassen.
Im vergangenen Sommer war ich mit meinem Freund wandern. Mein Rucksack drückte auf meine Schultern, die Hitze obendrauf. Überall auf dem Weg klebten Kuhfladen. Ich sprach meine Beobachtungen an. Nach dem zweiten oder dritten Kommentar antwortete mein Freund: »Du bist ganz schön jammerig heute.«
Das tat weh. Umso mehr, weil ich in den Monaten zuvor häufiger gehört hatte, ich sei jammerig oder negativ – von einer Freundin, beim Sport, in der Familie. Dabei war ich doch immer ein positiver Mensch, und konnte auch gut damit umgehen, wenn mir etwas nicht gepasst hat.
Zu viel Hitze, um joggen zu gehen: Ich konnte es kaum erwarten, mich beim Schwimmen auszupowern. Eine Autopanne beim Reisen: Ich nutzte die Zeit, um die Gegend zu erkunden. Eine Absage für die Journalismusausbildung: Schon einen Tag später beschloss ich, mich wieder zu bewerben, dafür hatte ich jetzt Zeit für ein Praktikum. Der Spruch »Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus«, hätte als Sticker auf meinem Spiegel kleben können.

Jammere ich inzwischen wirklich so viel?
Es ist November 2023. Weil mich das Thema nicht loslässt, öffne ich Google und tippe »Jammerlappen«. Das Ergebnis: ein Waschlappen mit zwei Augen. Dieses Etwas ist eine Handpuppe des Comedian Martin Reinl. Im ersten Video zieht diese Puppe, der Jammerlappen, seine Mundwinkel weit nach unten, seine Stimme ist knatschig. Während ich dem Jammerlappen zuhöre, muss ich schmunzeln. Zumindest so bin ich auf keinen Fall.
»Ich weiß jemanden, der ist ein extrem großer Jammerlappen«, sagt Reinl in einem anderen Beitrag. »Wenn ich dem diese Figur zeige, dann sagt er: Die finde ich lustig, die ist nämlich genau wie meine Tante.«
Ich schlucke. Was, wenn ich bin wie dieser Typ, der nur seine Tante sieht, aber nicht sich selbst?
Aber nein. Alles, was ich zum Beispiel auf der Wanderung mit meinem Freund gesagt habe, waren doch Tatsachen: Es war heiß. Mein Rucksack war schwer und auf dem Weg lagen mindestens 20 Kuhfladen. Auch als Freund:innen oder meine Familie behauptet haben, ich würde jammern, habe ich nur Fakten wiedergegeben: Der Auftrag war nun mal zu schlecht bezahlt, der Zug hatte wieder Verspätung.
Man muss doch noch sagen dürfen, was Sache ist, ohne gleich als Jammerlappen abgestempelt zu werden.
Die Frage der Wahrnehmung
Um herauszufinden, was als Jammern gilt und was nicht, verabrede ich mich mit Leoni Saechtling zum Videocall. Sie ist Psychologin und beschäftigt sich mit Themen wie Emotionsregulation und Resilienz. Als ich ihr von meinem Jammer-Dilemma erzähle, freut sie sich. »Oft kommen Menschen zu mir und sprechen darüber, dass in ihrem Umfeld so viel gejammert wird«, sagt sie. »Aber ich erlebe kaum, dass jemand bei sich selbst sucht.«
Ehrlicherweise suche ich vor allem nach Bestätigung dafür, dass ich nicht jammere.
Ich erzähle vom Wanderausflug mit meinem Freund, der Hitze und den Kuhfladen. Leoni Saechtling sagt: »Sie haben keine Tatsachen beschrieben. Sie haben bewertet.« Es sei wichtig, zwischen Wahrnehmung und Bewertung zu unterscheiden. Wahrnehmung ist das, was man durch die Sinneskanäle aufnehmen kann. Beispielsweise: Heute haben wir 36 Grad. Bewertung ist, wie man es empfindet. Also: Mir ist heiß. »Wenn man Dinge, die man nicht ändern kann, negativ bewertet und seinen Fokus auf sie richtet, jammert man.«

Verdammt. Es sieht so aus, als sei ich wirklich ein Jammerlappen. Aber so will ich nicht sein. Wenn meine Eltern über die vielen Baustellen in der Stadt, Kolleg:innen über zu hohe Arbeitsbelastung und Freund:innen über das Wetter lamentieren, erscheint mir das als Zeitverschwendung. Jetzt, selbst als Jammerliese abgestempelt, denke ich: Irgendeinen Zweck muss das Jammern doch haben. Oder?
Ein Affenlärm
Wenn Wissenschaftler:innen herausfinden wollen, wieso Menschen auf eine bestimmte Art handeln oder kommunizieren, analysieren sie häufig andere Primaten. Forschende am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen etwa beobachten Affen, um die Evolution von Signalen und Lauten zu verstehen. Vielleicht untersuchen sie ja auch das Jammern?
Ich schreibe eine Mail – Betreff: Interview zum Jammern – an Julia Fischer, die die Abteilung Kognitive Ethologie des Primatenzentrums leitet. Sie antwortet: »Ich habe viel zum Jammern zu sagen.«
Seit fast 25 Jahren beobachtet die Primatologin verschiedene Pavianarten im Freiland, unter anderem in Botswana oder im Senegal. »Wenn ich die Affenkinder im Freiland beobachte, höre ich sehr häufig Jammerlaute«, sagt Fischer am Telefon. »Das sind eigentlich ganz niedliche, harmonische Laute. So ein oh – oh.« Sie ahmt eine Art Grummeln nach.
Affenkinder jammern vor allem in einer Phase, in der sie sich von ihrer Mutter entwöhnen müssen. Es gebe dann Eltern-Kind-Konflikte, in denen die Mutter das Kind aus der Schlafgruppe ausstößt oder ihm das Trinken verweigert. Das Kind aber wolle Zuwendung und fange deshalb an zu jammern. Oft bringe es die Mutter dazu, nachzugeben. »Zirka anderthalb Jahre nach der Geburt aber kommt der Punkt, an dem die Mutter hartnäckig bleibt«, sagt Fischer. Also suchen die Affenkinder andere Strategien: Sie tun sich mit Gleichaltrigen zusammen, bilden eine eigene Schlafgruppe und finden ihr Futter selbstständig.
»Bei erwachsenen Pavianen existiert kein Ausdruck mehr für soziale Unzufriedenheit«, sagt Fischer. »Und obwohl wir nachweisen können, dass sie Stress empfinden, wenn zum Beispiel ein Verwandter stirbt, gibt es auch keinen Ausdruck für Trauer – kein Weinen oder Jammern. Keine wehleidigen Laute.«
Wie die Paviankinder habe auch ich als Baby geweint, damit meine Eltern mich füttern, hochnehmen oder schlafen legen. Und auch bei mir gab es irgendwann eine Phase, in der ich mich von meinen Eltern abgekapselt und gelernt habe, für mich selbst zu sorgen. Das Weinen und Jammern aber habe ich mit ins Erwachsensein genommen. Warum?
Zum ersten Mal denke ich: Vielleicht, weil Jammern manchmal guttut. Weil es hilft. Wenn die erwachsenen Paviane keinerlei Ausdruck für Trauer oder Leid haben, wie halten sie nur den Tod von Verwandten aus? In den Momenten, in denen ich mich von geliebten Menschen verabschieden musste, habe ich bisher immer geweint, auch danach noch geklagt. Oft hat mir das gemeinsame Trauern auf Beerdigungen geholfen, zu verstehen, was passiert ist. Und es hat mich weniger einsam fühlen lassen.
Ich erinnere mich daran, was die Psychologin Leoni Saechtling mir vor ein paar Tagen gesagt hat: Jammern kann helfen, negative Erlebnisse zu realisieren und sich mit anderen verbunden zu fühlen. »Wenn man in seinem Leid gesehen wird, kann man es eher loslassen.«
Ich möchte inzwischen gar nicht mehr hören, dass ich in Wahrheit nicht jammere. Aber ich möchte hören, dass mein Jammern berechtigt ist. Sinnvoll. Nur stolpere ich über einen Begriff, den die Psychologin benutzt: »Leid«. Wenn ich den Verlust einer geliebten Person betrauere oder über Krankheiten klage, wirft mir niemand vor, zu jammern. Die Dinge, über die ich jammere, – Wetter, unbeantwortete E-Mails, steile Berge – sind kein Leid. Sie sind höchstens lästig. Lästig für mich, weil etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und lästig auch für andere, weil ich sie mit meiner Jammerei nerve.
Vom Sonnenschein zum Regentropfen
Wochen, nachdem ich meine Recherche zum Jammern gestartet habe, stehe ich auf dem Dachboden und suche nach Weihnachtsdeko. Dort verstauben auch Kisten voller alter Dokumente: Urkunden, Briefe, Magazine. Irgendwo in diesen Kisten liegt ein Zeitungsausschnitt. Darauf ist ein Foto von mir als Kind, ich bin damals wahrscheinlich so sieben Jahre alt. Zu meinem Geburtstag habe ich ein Schnorchelset mit Taucherflossen bekommen. Weil ich nicht abwarten konnte, bis wir damit ins Schwimmbad gingen, habe ich das Geschenk in der Badewanne getestet. Die Wanne war viel zu klein für meine Flossenfüße, und viel zu flach, um wirklich tauchen zu können. Aber ich war überglücklich. Meine Mama fotografierte mich – und so landete ich in der Lokalzeitung. Die hatte damals Eltern gebeten, Fotos von ihren Kindern einzureichen, die sie zum Lächeln bringen. Die Aktion hieß: »Unser Sonnenschein«.

Wie kann es sein, dass mir dieser Sonnenschein abhanden ging?
In einem Radiobeitrag, den ich zu Beginn meiner Recherche gehört habe, sagt der Psychiater Joachim Küchenhoff: Menschen, die auf hohem Niveau jammern, wüssten nicht so recht, was sie suchen. Als Kind, das in der Badewanne schnorcheln ging, suchte ich vielleicht Abenteuer, machte mir aber kaum Gedanken darüber, was ich vom Leben möchte. Damals passten meine Eltern darauf auf, welchen Weg ich nehme. In der Schule dann war es einfach, ein Ziel zu definieren: fertig werden, ins Ausland gehen, das passende Studienfach finden. Im Studium suchte ich Hausarbeitsthemen, Praktikumsplätze und einen Weg in den Journalismus. Mit Abschluss meiner journalistischen Ausbildung war dieser Schritt auf einmal geschafft.
Und dadurch standen so viele Fragen im Raum: Wo will ich leben und arbeiten? Wo ist mein Platz in dieser umkämpften Branche? Was ist mir im Leben wichtig? Vielleicht war dieser Moment der erste in meinem Leben, in dem ich nicht mehr wusste, was ich suche.
Die vier Grundbedürfnisse
Der Psychologe Klaus Grawe formuliert in seinen Büchern vier menschliche Grundbedürfnisse. Laut Grawe strebt der Mensch danach, diese zu erfüllen. Als ich das lese, denke ich: Vielleicht können mir diese Kategorien ja helfen, herauszufinden, was ich eigentlich suche.
Das erste Bedürfnis, das Grawe formuliert: Bindung. Zumindest das kann Jammern auf jeden Fall leisten. Wenn ich über das schlechte Wetter klage und jemand bestätigt mich, leiden wir gemeinsam unter den grauen Tagen – das verbindet.
Diese Dynamik entsteht allerdings nur, wenn mein Gegenüber in das Jammern einsteigt. Ist das nicht der Fall, bleibt mein Bedürfnis nach Bindung unerfüllt. Schlimmstenfalls ist die andere Person von der Jammerei genervt. Und dann bekomme ich erst recht nicht das, was ich eigentlich brauche – eine Umarmung oder ein offenes Ohr. Jammern kann also heißen: Eigentlich sucht man nach Liebe, oder zumindest nach einem Gefühl der Nähe und Unterstützung.
Das zweite Bedürfnis, das Grawe nennt, ist das nach Kontrolle und Orientierung. Demnach braucht der Mensch das Gefühl, die Welt verstehen und seine Umwelt selbst gestalten zu können. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen jammern, wenn sie sich als Opfer der Umstände erleben und eine Art Hilflosigkeit verspüren. Dieses Gefühl kenne ich aus den vergangenen Jahren nur zu gut: Corona, Kriege, Klimakrise. All diese Krisen waren oder sind so groß, so mächtig. Wie soll einen da nicht ein Gefühl der Hilflosigkeit ergreifen?
Ein weiteres Bedürfnis, das Klaus Grawe formuliert, ist das nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Ich denke an die Wanderwege voller Kuhfladen. Eine ziemliche Unlust, darauf zu laufen. Aber vielleicht kann ich mich das nächste Mal mehr auf die frische Luft oder den schönen Ausblick konzentrieren. Manchmal liegt zwischen Jammern und Jauchzen nur ein Perspektivwechsel.
Selbstwerterhöhung und -erhaltung ist der letzte Punkt, den Grawe zu den vier Grundbedürfnissen des Menschen zählt. Darunter versteht er den Wunsch, sich als gut anzusehen und Bestätigung zu erhalten. An diesem Punkt bleibe ich hängen.
Mein Selbstwert ist etwas, mit dem ich schon seit einiger Zeit hadere. Früher, in der Schule und im Studium, war ich ehrgeizig, habe mich immer bemüht, den Fleißstempel oder eine Eins Plus zu bekommen. Gleichzeitig hatte ich viele Hobbys und Freund:innen, wollte schon damals Turnen, Klavierspielen und Schule unter einen Hut kriegen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich jahrelang Schularbeiten früh im Bus oder spät in der Nacht erledigt habe, weil ich tagsüber noch so viele andere Dinge tun wollte. Es war schon damals keine Option für mich, eine Hausaufgabe nicht zu machen, einer Freundin abzusagen oder einfach mal Pause zu machen. Und hat mir nicht jede gute Note bestätigt, dass es sich lohnt, zu funktionieren?
Ich glaube, ich definiere mich noch immer darüber, jede Minute meines Lebens zu nutzen. Vor ein paar Wochen noch erschienen mir Autopannen und Absagen, die ich in etwas Positives verwandelte, als Beweis für meine positive Art. Was aber, wenn das nicht Optimismus ist, sondern einfach nur Zwang zur Produktivität? Aus der Zitrone eine Limonade zu machen, heißt im Endeffekt nur: mein Leben effizient nutzen.
Aber irgendwann braucht jeder eine Pause. Manche sagen, man wird krank, wenn der Körper einem signalisieren will, dass er Ruhe braucht. Vielleicht ist das mit dem Jammern ja ähnlich: Es ist meine Art der Pause. Die Schuld, dass ich nicht jede Minute effizient nutze, trage dann nicht ich, sondern die verspätete Bahn, das schlechte Wetter, der kaputte Laptop. So kann ich mich weiterhin darüber definieren, dass ich alles schaffe, was ich mir vornehme, ohne mir eingestehen zu müssen, dass auch ich Auszeiten brauche.
Wie mein Gehirn Emotionen steuert
»Niiiiiiiiiemand gibt mir ein Interview«, jammere ich ein paar Wochen später. Es ist kurz vor Neujahr. Mein Freund sitzt auf dem Sofa und hört sich meinen Frust an. Um zu verstehen, wie man sich vom Sonnenschein zum Jammerlappen (und hoffentlich auch wieder zurück) verwandeln kann, wollte ich mein Gehirn verstehen: Was ändert sich dort, wenn ich wieder und wieder negativ denke? Und kann ich meine grauen Zellen wieder umprogrammieren? Nur: Kein:e Neurowissenschaftler:in kann oder will mit mir übers Jammern sprechen.
Ich versuche es mit einem verwandten Themengebiet – Emotionsregulation – und frage die Psychologin Saz Ahmed für ein Interview an. In ihrer Doktorarbeit wollte Ahmed wissen, welche Gehirnareale aktiviert werden, wenn man seine Emotionen reguliert – also beispielsweise, wenn man in einer Situation, die einen ärgert, seine Wut unterdrückt. Und sie wollte herausfinden, ob je nach Strategie, mit der man seine Emotionen kontrolliert, andere Hirnareale aktiv sind. Für ihre Untersuchungen nutzte die Wissenschaftlerin funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT). Diese Methode ermöglicht es, aktivierte Gehirnareale bildlich darzustellen, indem sie misst, wo das Gehirn gerade mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird.
»Immer, wenn extreme Emotionen im Spiel sind, leuchtet auf dem Bild des fMRT-Scans eine aktivierte mandelförmige Struktur im Gehirn auf, die Amygdala«, erklärt Saz Ahmed. »Vor allem bei Angst, aber auch bei Wut oder Freude.« Und auch der Präfrontale Cortex, das Entscheidungs- und Kontrollzentrum des Gehirns, spielt eine Rolle bei der Emotionsregulation. »Wenn in der Amygdala ein Feuer ausbricht, dann bedeckt der Präfrontale Cortex es gewissermaßen mit einem feuchten Handtuch«, sagt Ahmed. »Er beruhigt unsere Gefühle und bestimmt, wie wir mit ihnen umgehen.«

Außerdem hat die Wissenschaftlerin herausgefunden, dass vor allem die Verbindung zwischen Amygdala und Präfrontalem Cortex entscheidend ist, um Emotionen gut zu regulieren. Bei Menschen mit Depressionen oder Angststörungen zum Beispiel sei diese eher gering ausgeprägt, erklärt Ahmed. Aber auch gesunde Menschen könnten Momente haben, in denen ihre Emotionsregulation nicht gut funktioniert: Am Ende eines schwierigen Tags, an dem das Gehirn viele Emotionen kontrolliert und gesteuert hat, könne es sein, dass der Präfrontale Cortex erschöpft ist und nicht mehr so gut arbeitet wie am Morgen.
Ich erinnere mich an eine Bergtour, die mein Freund und ich in unserem Korsika-Urlaub unternahmen: 900 Höhenmeter, Wege voller Geröll, 32 Grad Celsius. Ich kam fast durch den ganzen Tag, ohne zu jammern. Doch als am Ende der Weg immer steiniger wurde, beschwerte ich mich durchgehend, bis wir wieder am Auto waren. Ich kann mir vorstellen, wie erschöpft mein Präfrontaler Cortex gewesen muss.
Zwischen den Stühlen
Inzwischen ist Januar – und ich bekomme doch noch die Chance, mit einem Neurowissenschaftler zu sprechen. Henning Beck beschäftigt sich vor allem damit, wie Menschen denken, lernen und verstehen. Ich erzähle ihm von meinem Jammerausbruch auf dem steinigen Weg in den korsischen Bergen. »Das Jammern könnte in diesem Moment eine ähnliche Funktion haben wie Fluchen«, sagt Beck. »Wenn jemand Schimpfwörter nutzt, sind die Areale im Gehirn, die Schmerz verarbeiten, weniger aktiv als bei Menschen, die nicht schimpfen und Schmerzen haben.« Fluchen lenke ab und helfe dem Gehirn dadurch, mit Situationen umzugehen, die es so nicht vorhergesehen hat. Der Effekt: Menschen, die fluchen, halten Schmerzen besser aus und bringen bessere Leistung.
Damit spricht der Neurowissenschaftler einen Punkt an, der in meiner Recherche immer wieder aufgekommen ist: Leistung bringen. Vielleicht ist das in Wahrheit das Problem: Dass ich denke, ich muss immer alles geben. Dass ich selbst im Urlaub 900 Höhenmeter erklimmen und in meiner Freizeit unrealistische To-Do-Listen erfüllen will. Jedes Mal ertappe ich mich wieder bei dem Gedanken, ich müsse mich nur genug anstrengen.
In den vergangenen Jahren habe ich an zwei Orten gleichzeitig gewohnt. Der eine war die Stadt meines Jobs, da war die Arbeit, da waren die Kolleg:innen. Am anderen Ort warteten mein Freund und meine Familie, mein Privatleben. Es gab so viele Tage, an denen ich spät nach Hause zurückkam und mitten in der Nacht anfing, stundenlang die Küche aufzuräumen und Blumen zu gießen, in dem Versuch, wieder anzukommen. Runterzukommen. Momente, in denen ich mit einer riesigen Unruhe im Bauch hin und her pendelte. Zeiten, in denen das Gefühl, unter Strom zu stehen, nicht verschwinden wollte. Ich denke an meine zwei Jobs. An die Angst als freie Journalistin, keine Aufträge zu haben, und die Angst als Angestellte, Freiheiten und Träume aufzugeben. Ich habe so viele innere Kämpfe geführt, weil ich mir nicht sicher war, ob diese Art zu leben die richtige für mich ist. Aber ich bin trotzdem immer weiter durch mein Leben gerast.

Vielleicht ist meine Jammerei ja ein Warnsignal, das mir zeigt, dass ich etwas ändern muss.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich in den vergangenen Jahren nicht das Leben geführt, das ich mir wünsche. Das lag vor allem daran, dass ich Angst hatte, etwas zu verlieren, wenn ich mich für einen Weg entscheide – für einen Job oder einen Wohnort. Wie viele Menschen in meinem Alter bin ich aufgewachsen mit dem Gefühl, alle Möglichkeiten zu haben: Ich dachte immer, wenn ich nur genug Leistung bringe, kann ich alles sein und tun. Mir ist klar, dass das zeigt, wie privilegiert ich aufgewachsen bin. Aber gleichzeitig erfordert es Mut, den eigenen Weg auch wirklich zu gehen, Prioritäten zu setzen, Entscheidungen zu treffen. Und auch mal endgültig auf Möglichkeiten zu verzichten. Denn sich nicht zu entscheiden, birgt die Gefahr, das zu verlieren, was einen ausmacht: meinen inneren Sonnenschein.
Was will ich?
Was also will ich? Ich finde es verdammt schwierig, diese Frage für mein Leben zu beantworten. Woher soll ich wissen, welche Tür ich öffnen und welche ich schließen soll? Woran erkenne ich den für mich richtigen Weg? Als Kind haben mir meine Eltern geholfen. Jetzt, als Erwachsene, muss ich die Richtung selbst bestimmen – und dafür einstehen. Das macht Angst, weil es sein kann, dass ich mich falsch entscheide.
Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, mal falsch abzubiegen. Denn irgendwann wird man es merken. Man wird jammern, fluchen, ausbrechen. Und man wird dadurch klarer sehen, was einem wirklich wichtig ist. Auch meine Jammerei hat mir gezeigt, dass ich etwas ändern muss – und wie wichtig Nähe und Zuspruch für mich sind. Denn wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ist es das, was ich hören will, wenn ich jammere: Auch wenn dieser Artikel nichts wird, auch wenn wir diese Wanderung abbrechen, auch wenn du falsch entschieden hast, bist du gut, so wie du bist. Am Ende ist es dieses Gefühl, angenommen zu werden, das meine Ängste schmälern kann.
Ich denke an die Primatologin Julia Fischer, die die Kommunikation der Paviane erforscht. Wenn sie die erwachsenen Affen beobachtet, hört sie oft ein Grunzen, das Ausdruck positiver Stimmung und des Bedürfnisses nach Bindung und Nähe ist. »Wenn sich zwei Affen annähern und beide grunzen, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich hinterher das Fell kraulen«, hatte Fischer erklärt. Das Verrückte ist: Diese Grunzlaute, so vermutet es die Primatologin, könnten sich aus den Jammerlauten entwickeln, die die Paviankinder von sich geben. Vielleicht haben die Affen gelernt, dass sie mit positiven Ausdrücken mehr Erfolg haben, Nähe und Zuspruch zu bekommen.
Und vielleicht fange auch ich gerade an, das zu lernen.
Erschienen am 15. Februar 2024
Newsletter
Jeden Monat ein Thema. Unseren Newsletter kannst du hier kostenfrei abonnieren: