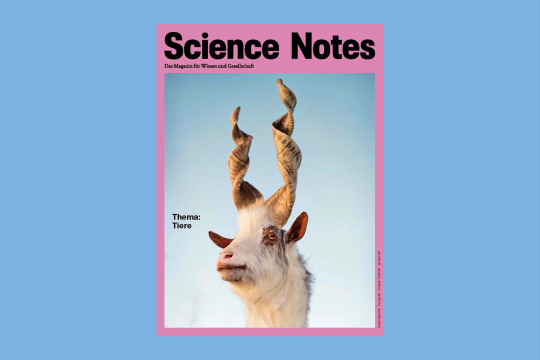Geil, Brokkoli-Nuss-Ecken!
Wenn die Leute wissen, welche CO₂-Bilanz ihr Essen hat, ernähren sie sich dann klimafreundlicher?
Gyros mit Pommes ist der Knaller in der Kantine: fettig, salzig, ganz schön geil. Da drängelt sich mittags ein Großteil der Belegschaft vor der Essensausgabe, berichtet Andreas Bschaden. Mit kaum einem anderen Essen macht die von Bschaden untersuchte Betriebskantine einen ähnlich hohen Umsatz. Mit kaum einem anderen Essen haut die Kantine aber auch so kräftig in die Klimabilanz, leider.
So komplex die Berechnung dieser Bilanzen in der Ernährung auch ist, eines steht fest: Fleischgerichte, so wie das Schweine-Gyros, haben fast immer einen deutlich größeren Klima-Fußabdruck als vegetarisches Essen. Klar: Stallfläche, Ausscheidungen, phänomenal schlechter Umsatz von Futter- in Nahrungskalorien, Transport, Kühlung – alles bekannt. Weniger bekannt: Auch Pommes sind nicht klimafreundlich, weil oft stark verarbeitet und unter großem Energieaufwand frittiert. So bringt es die Portion Gyros mit Pommes auf eine stolze Bilanz von über drei Kilogramm CO2-Äquivalenten. Diese Einheit gibt an, welche Wirkung alle in einem Prozess entstehenden Treibhausgase haben; damit man sie gut vergleichen und zusammenfassen kann, werden sie alle umgerechnet in die Wirkung von CO2. Das XXL-Schnitzel vom Schwein mit Pommes, ein anderes Lieblingsgericht in der Kantine, übertrifft sogar die Marke von fünf Kilo CO2-Äquivalenten.

Stellen wir uns nun den hageren Kollegen vor in dieser Betriebskantine, der etwas abseits sitzt, mit seinen Brokkoli-Nuss-Ecken auf dem Teller, einer Portion Eblysotto und Pfannengemüse. Lassen wir ihn in die fettglänzenden Gesichter der Gyros-Fraktion schauen und murmeln: »492 Gramm Kohlenstoffdioxid auf meinem Teller. Wenn ihr nur wüsstet!«
Ja, wenn die nur wüssten. So ungefähr war auch der Gedanke von Andreas Bschaden, als er eine Studie im Rahmen seiner Doktorarbeit konzipierte. Bschaden ist studierter Soziologe. An der Universität Hohenheim promoviert er am Institut für Ernährungsmedizin. Als Ernährungssoziologe interessiert er sich dafür, warum Menschen so essen, wie sie essen. Also zum Beispiel, warum sie bestimmte Gerichte auswählen und andere nicht – und auch, ob und wie sie sich in dieser Wahl beeinflussen lassen.
Eine Überblicksstudie der schwedischen Ernährungswissenschaftlerin Elinor Hallström hat gezeigt: Eine Person kann den CO2-Fußabdruck ihrer Nahrung um rund 30 Prozent verringern, wenn sie auf vegetarische Ernährung umsteigt. Der Wechsel zu veganer Ernährung kann den Fußabdruck gar um 50 Prozent reduzieren im Vergleich zu einer für europäische Länder durchschnittlichen, fleischhaltigen Diät. Wenn die Menschen nun also beim Mittagessen genau wüssten, welchen CO2-Fußabdruck ein bestimmtes Gericht hat – würden sie sich davon beeindrucken, in ihrer Essenswahl beeinflussen lassen?
Bschaden machte sich auf die Suche nach Kooperationspartnern. Was nicht einfach war, wie er erzählt, denn wer Essen verkaufen will, vergrault seine Kundschaft lieber nicht mit Klimazahlen. Doch über die Dauer seines Projektes, zwischen 2018 und 2022, konnte Andreas Bschaden vier verschiedene Partner finden und vier verschiedene Settings untersuchen: die Kantinen eines großen Unternehmens im Raum Stuttgart, eine Mensa der Uni Hohenheim, ein klassisches Restaurant mit Tischservice und Speisekarte sowie einen Food Truck.
Über Zeiträume von zwei bis vier Wochen hinweg erhob Bschaden zunächst die Umsatzzahlen: Welche Gerichte werden wie häufig bestellt? Damit hatte er die Vergleichswerte, die er für seine Interventionsstudie brauchte.
Dann machte er sich mit Kolleg:innen an die mühsame Arbeit, die Klimabilanzen aller Gerichte zu bestimmen – mithilfe einer Datenbank namens Eaternity. Sie stellt sogenannte Life-Cycle-Analysen für eine große Zahl an Nahrungsmitteln zur Verfügung. Bei diesen Analysen wird versucht, die Klimabilanz eines Produktes über alle Produktionsschritte hinweg möglichst genau zu bestimmen. Mit diesen Daten wiederum kalkulierten die Wissenschaftler:innen die Werte der angebotenen Gerichte – teils mussten sie dafür erst die Kochrezepte studieren, um Zutaten und Verarbeitungsschritte zu kennen. Letztlich hatte Bschaden dann für jedes Gericht auf den Speisekarten einen genauen Wert für die Klimabilanz, ausgedrückt in CO2-Äquivalenten.
Nun konnten die Wissenschaftler:innen ihre eigentlichen Daten erheben: Sie baten die verschiedenen Einrichtungen, die Speisepläne aus den Kontrollzeiträumen jeweils exakt zu wiederholen. Die Menschen konnten ihr Mittagessen also aus dem genau gleichen Angebot auswählen wie ein paar Wochen zuvor. Einziger Unterschied: Auf den Speisekarten war hinter jedem Gericht die Klimabilanz in Gramm CO2-Äquivalente angegeben, teilweise ergänzt um ein einordnendes Symbol. Das war die Intervention, der Knackpunkt der Studie.
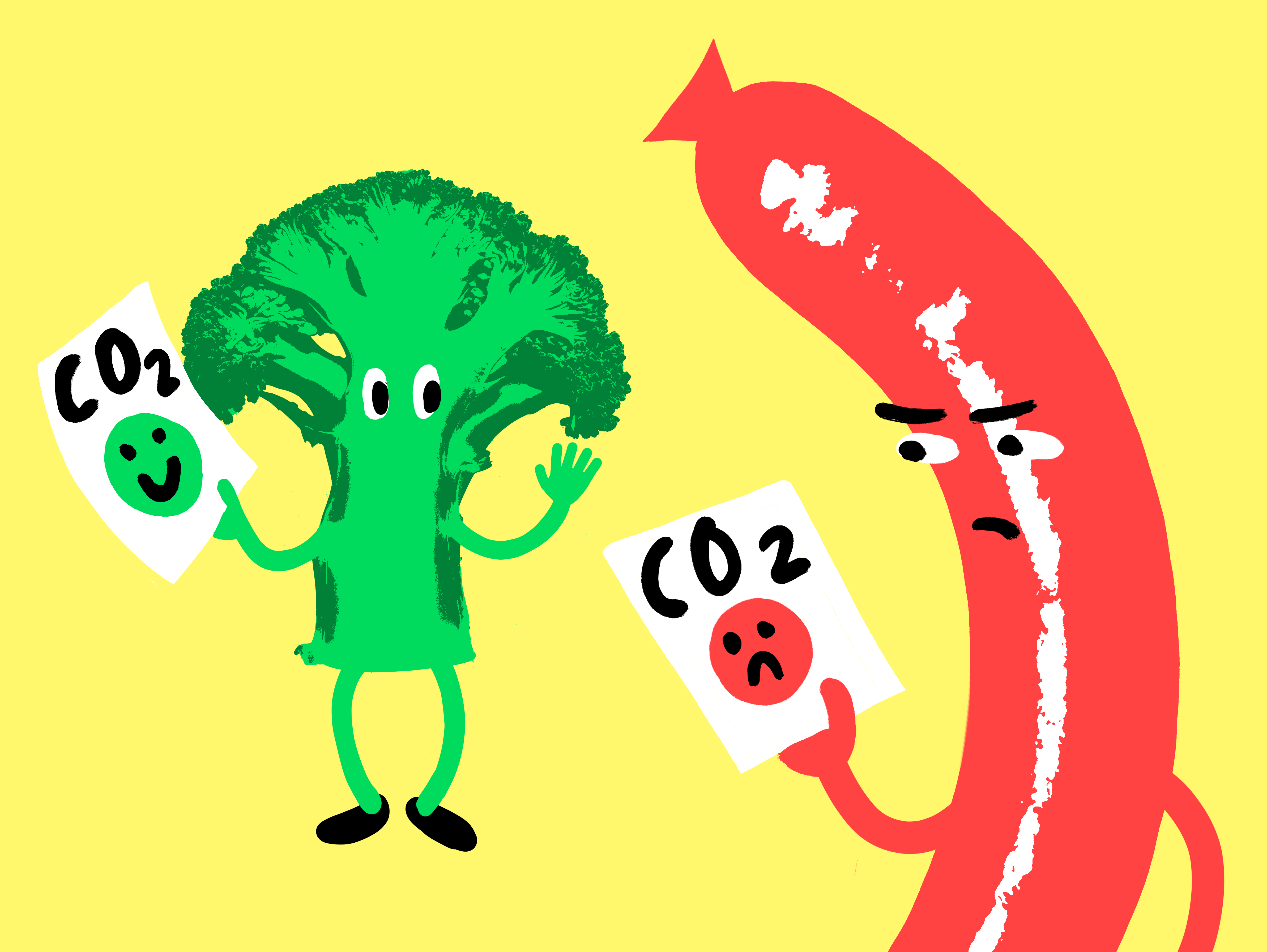
Die Gyros-Esser:innen in den Stuttgarter Kantinen wussten nun also um die Bilanz ihres Mittagessens.
Und sie änderten: nichts.
Die Restaurantbesucher:innen: nichts.
Auch bei den Food-Truck-Kund:innen tat sich wenig.
Noch nicht einmal die Student:innen in der Uni-Mensa ließen sich von den Zahlen auf der Speisekarte beeinflussen.
»Da waren wir doch enttäuscht«, erzählt Andreas Bschaden. »Wir hatten schon erwartet, dass da etwas passiert.«
Bschaden schaute nochmal genau auf seine Daten. Verglich einzelne Gerichte miteinander. Verglich die Standorte der Betriebskantinen: Gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen der Kantine im Entwicklungszentrum, in der die Akademiker:innen speisen, und der Kantine in der Produktion? Er suchte nach zeitlichen Effekten. Nach sonst irgendwelchen Effekten. Und fand: nichts. Zumindest keinen signifikanten Rückgang der CO2-Bilanzen bei der Essenswahl.
Es ist also wohl so, dass die CO2-Werte hinter den Gerichten, dass diese Appelle an die Vernunft der Esser:innen schlichtweg verhallen zwischen dem lauten Geklapper der mit Gyros beladenen Teller. Vielleicht nicht ungehört – aber jedenfalls auch nicht beherzigt.
Besonders deutlich wird das an den Daten vom Food Truck. Denn hier konnten die Kund:innen nur aus drei Gerichten und drei Beilagen wählen: Maultaschen mit Fleisch, ohne Fleisch oder mit Fleisch und Käse, dazu grüner Salat, Kartoffelsalat oder Kässpätzle. Zwar konnte Bschaden feststellen, dass der Anteil der verkauften Fleischmaultaschen im Zeitraum seiner Intervention ein wenig zurückgegangen war; doch dafür hatten sich mehr Leute für die weniger klimafreundlichen Kässpätzle als Beilage entschieden. Im Schnitt sank der Gesamtwert pro verkaufter Portion von 632 auf 602 Gramm CO2. Das sind zwar knapp fünf Prozent weniger – doch damit gilt das Ergebnis nicht als statistisch signifikant. Kaum ein Unterschied also, trotz der Information über die Bilanz.
Warum haben die Informationen keinen Effekt? Bschaden kann über die Gründe bisher nur spekulieren: »Ich denke, diejenigen, die ein Interesse für dieses Thema haben, wählen ohnehin schon die umweltfreundlichere Variante. Und diejenigen, die Fleisch essen wollen, lassen sich von den Zahlen nicht beeindrucken.«
Immerhin, die Aktion an sich kam gut an: Bei einer Befragung der Kund:innen von Food Truck und Restaurant fanden gut 80 Prozent der Teilnehmenden »die bereitgestellten Informationen interessant«, fast ebenso viele wünschen sich »häufiger im Alltag eine CO2-Werte-Beschriftung bei Gerichten oder Lebensmitteln«.
Veränderungsprozesse, die rein von Informationen und Vernunft getrieben werden, sind schwierig und zäh. Es ist deutlich effektiver, Menschen emotional anzusprechen. Oder etwa, ihre Bequemlichkeit zu nutzen. Aus anderen Ernährungsstudien ist bekannt, dass Nudging erfolgreich sein kann: kleine Tricks also, die Verbraucher:innen unbewusst in eine gewünschte Richtung schubsen, ohne dass ihnen daraus ein Nachteil entsteht. Beispielsweise macht es einen Unterschied, ob das vegetarische Essen als erste Wahl präsentiert wird oder etwa als Alternativessen zum Fleischgericht. Ob Fleisch explizit abbestellt oder aber explizit dazu bestellt werden muss. Oder ob das vegetarische Gericht weiter vorne an der Theke angeboten wird und die Kund:innen für das Fleischgericht ein paar Schritte mehr gehen müssen.
Dennoch will Andreas Bschaden weiter forschen, was die bewussten Konsumentscheidungen angeht. Um schneller Effekte zu erzielen, könnte man auf die Entscheider:innen zugehen, die im Prozess weiter oben stehen, sagt Bschaden: »Es würde viel mehr Sinn ergeben, gezielt die Köch:innen zu schulen. Oder die Studierendenwerke, die Kommunen, die Firmen direkt zu informieren und zu beeinflussen« – die dann wiederum bei den Speiseplänen ansetzen, beim Angebot also.
»Geil, Brokkoli-Nuss-Ecken!«, hören wir dann den hageren Kollegen öfter jubeln. Und dann setzt er sich mit seinem Tablett zu den anderen an den Tisch, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und alle freuen sich, dass das vegane Gyros auch voll lecker ist.
Erschienen am 16. Mai 2024
Newsletter
Jeden Monat ein Thema. Unseren Newsletter kannst du hier kostenfrei abonnieren: