Wie blicken deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf ihren Aufenthalt in den USA zurück? Wie blicken sie den Wahlen entgegen? Und was werden sie vermissen an den USA? Drei Forschende erzählen.

Über Jahrzehnte hinweg waren die USA das gelobte Land für die Wissenschaft – und für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt. Leuchtturm, Vorbild, Sehnsuchtsort, Karriereturbo, unangefochtener Nobelpreisrekordhalter unter den Nationen. Doch die Stimmung änderte sich, als Donald Trump 2016 Präsident der USA wurde. Das schlägt sich unter anderem in den internationalen Beziehungen nieder: Der akademische Austausch zwischen Deutschland und den USA war lange ein gut funktionierendes Geben und Nehmen. Auch heute noch forschen der »Open Doors«-Datenbank des Institute of International Education in New York zufolge knapp 5.000 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA – nicht eingerechnet sind Studierende und Deutschstämmige, die inzwischen einen US-amerikanischen Pass haben. Doch die Attraktivität der USA für Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt nimmt zunehmend ab.
Zum einen liegt das an konkreten politischen Entscheidungen der Trump-Administration. Ein beispielhafter Tiefpunkt, nach dreieinhalb Amtsjahren und unzähligen Seitenhieben gegen die akademische Welt: der Vorschlag im September 2020, Visa für Studierende und Forschende generell auf vier Jahre zu beschränken – mit Ausnahme von Menschen, die aus den von Trump abfällig als »shithole countries« betitelten Ländern kommen. Für sie soll der wissenschaftliche USA-Austausch generell spätestens nach zwei Jahren beendet sein.
Zum anderen verschreckt Trump die internationalen Gäste auch schlichtweg durch seine aggressive Rhetorik und die entstandene Atmosphäre der Spaltung und des Hasses. Das ist jammerschade für den freiheitsliebenden, aufgeschlossenen Teil der Menschen in den USA. Und es ist eine ernste Bedrohung für das akademische System: Denn Universitäten in den USA sind immer auch Wirtschaftsunternehmen. Sie finanzieren sich zu einem großen Teil aus den teils horrenden Studiengebühren – und allein die 1,1 Millionen internationalen Studierenden in den USA spülten 2019 rund 41 Milliarden US-Dollar in das System. Wenn die Studierenden fehlen, fehlt das Geld – und ohne Geld lässt sich keine Spitzenforschung finanzieren. Die Wissenschaft in den USA könnte am Anfang einer fatalen Abwärtsspirale stehen. Wir haben mit einer Wissenschaftlerin und zwei Wissenschaftlern gesprochen, die die USA verlassen haben.
»Hast du auch Kontakte ins europäische Ausland?«
Peter Loskill forscht an Stammzelltechnologien und an Organ-on-a-Chip-Modellen. Für drei Jahre war er als Postdoktorand an der University of California in Berkeley, bevor er im Januar 2016 mit einem Forschungsstipendium als Juniorprofessor ans Fraunhofer IGB in Stuttgart und die Universität Tübingen wechselte. Kontakte für seine Rückkehr knüpfte er über das GAIN-Programm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes.
Insgesamt ist die Wissenschaft in den USA mehr auf Wettbewerb ausgelegt. Es gibt Horrorgeschichten über Arbeitsgruppen, die reihenweise Postdoktoranden verbrennen. So etwas habe ich selbst glücklicherweise nicht erlebt. Aber einer unserer Kooperationspartner hat seine Gruppenmeetings immer am Samstag abgehalten – das war schon bezeichnend.
Mir ist auch schnell aufgefallen, wie unterschiedlich die Qualität der Wissenschaft ist, je nachdem, wie renommiert eine Universität ist. Mit Berkeley hatte ich das Glück, an einer Topadresse gelandet zu sein. Die Wissenschaft an diesen Spitzenunis ist sehr international. In meiner Arbeitsgruppe gab es mit mir insgesamt sieben Postdocs – und keiner von uns war US-Amerikaner. Zum einen liegt das daran, dass dort gar nicht so viele gute Leute ausgebildet werden können, wie gebraucht werden. Zum anderen ist es aber auch so, dass Amerikaner nach ihrem Studium hoch verschuldet sind, oft über mehrere hunderttausend Dollar. Die können es sich nicht leisten, einen akademischen Weg einzuschlagen – die wollen direkt in die Wirtschaft und so schnell wie möglich einen gut bezahlten Job.
»Wer Erfolg hat und einen guten Job, hat ein tolles Leben. Sonst hat er ein großes Problem.«
In den USA sind die Möglichkeiten als Wissenschaftler sicher noch größer als in Deutschland. Und gerade in Kalifornien ist es ja auch sonst wunderschön. Wer Erfolg hat und einen guten Job, der hat dort ein tolles Leben. Aber wenn nicht, dann hat er ein großes Problem. Auf meinem Weg zur Uni bin ich morgens an richtigen Zeltdörfern vorbeigekommen, in denen Obdachlose leben. »Win or lose«– diese amerikanische Haltung hat mich da schwer beschäftigt. Ich habe mir also die Frage gestellt: Will ich langfristig in diesem Gesellschaftssystem leben?
Letztlich habe ich mich zur Rückkehr nach Deutschland entschlossen. Ich bin definitiv froh über diesen Schritt. Mit den Möglichkeiten, die ich hier habe, bin ich auch zufrieden.
Unter Donald Trump haben sich viele der gesellschaftlichen Extreme noch verschärft. Von den Internationalen unter meinen ehemaligen Kollegen höre ich oft: »Wenn er nochmal gewählt wird, gehe ich zurück.« Auch hier in Deutschland bemerke ich einen Wandel als Arbeitsgruppenleiter: Ich bekomme viel mehr internationale Bewerbungen als früher, etwa aus asiatischen Ländern. Die wären früher alle in den USA gelandet. Und auch bei den Nachwuchswissenschaftlern gibt es ein Umdenken: Die Generation, die jetzt in die USA gehen würde, sucht sich Alternativen. »Hast du denn auch Kontakte ins europäische Ausland?«, werde ich immer öfter gefragt.
Vergiftungen und Infektionen
Nach seiner Habilitation an der Ruhr-Universität Bochum kam der Theaterwissenschaftler Sebastian Kirsch für das Projekt »Atembilder. Hermann Brochs Atmosphärenpoetik« mit einem Stipendium der Humboldt-Stiftung ans German Department der New York University. Künftig arbeitet er am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin.
In New York habe ich an einem Forschungsprojekt über den österreichischen Schriftsteller Hermann Broch gearbeitet und mich dabei besonders für seine Massenwahn-Theorie interessiert: Broch hat sich ab den 1930er-Jahren in seinen Romanen und in theoretischen Versuchen mit psychotischen Massenphänomenen befasst. Unter anderem schrieb er über Vergiftungen und Infektionen in atmosphärischen Räumen und entwickelte eine regelrechte Poetik und Theorie des Atmens. Als die Corona-Krise Anfang des Jahres in den USA ankam, war mein literaturwissenschaftliches Projekt also plötzlich hochaktuell.
Nach meiner Habilitation bin ich mit einem Humboldt-Stipendium nach New York gegangen, unter anderem, weil dort ein Großteil von Brochs Nachlass lagert. Im Mai 2019 sind meine Frau, unser Sohn und ich angekommen, 18 Monate lang wollten wir bleiben. Daraus wurde nichts. Im März 2020 sind wir wegen Corona schon wieder abgereist – weil wir keine Kinderbetreuung mehr hatten und weil wir das Gesundheitssystem in den USA mittlerweile gut genug kennen, so dass wir nichts riskieren wollten mit einem Dreijährigen. Meine Arbeit musste ich vom deutschen Homeoffice aus beenden.
Corona hat auch in New York viele schon bestehende Probleme deutlicher gemacht. Die Enge der Stadt zum Beispiel: An der New York University habe ich mir ein Einzelbüro mit drei anderen geteilt – wir haben im Schichtbetrieb gearbeitet. Oder die irrwitzigen Lebenshaltungskosten: Für die Kita haben wir im Monat 2.000 Dollar gezahlt – was noch günstig ist. Auch unsere Wohnung galt als Schnäppchen: 2.600 Dollar Monatsmiete für 60 Quadratmeter. Wären wir während des Shutdowns geblieben, wären wir darin über Monate zu dritt eingesperrt gewesen, ohne Kinderbetreuung und Arbeitsräume. Dass New York eine anstrengende Stadt ist, war uns schon vorher bewusst. Aber mit dieser Entwicklung hatten wir natürlich nicht gerechnet.
»Es liegt ein wenig Mehltau über allem.«
Das Wissenschaftssystem in Deutschland hat ein großes Problem: Es gibt kaum mehr einen Mittelbau. Professorenstellen sind rar, und wer keine bekommt, kann an der Universität nicht mehr arbeiten. In den USA gibt es mehr Stellen unterhalb der Professur. In diesem Punkt haben die amerikanischen Universitäten einen Vorteil, obwohl die Anstellungssituation auch dort häufig prekär ist.
In meinem Umfeld an der Uni waren, wenig überraschend, alle gegen Trump. Aber was nützt das? In dieser Hinsicht habe ich die Atmosphäre als eher gedämpft wahrgenommen, manchmal auch als offen depressiv; es liegt ein wenig Mehltau über allem. Donald Trump hat im Wahlkampf, auch schon vor Corona, immer wieder versucht, gezielt Hoffnungslosigkeit unter seinen Gegnern zu verbreiten – etwa mit so absurden Aussagen wie der, dass er die Wahl nur verlieren könne, wenn sie manipuliert werde. In früheren Fällen hat ihm so etwas genutzt. Falls er tatsächlich an der Macht bleiben sollte, wird er sicher weiter versuchen, Fördergelder stark zu beschneiden, gerade auch in den Geisteswissenschaften. Es wird lange dauern, bis in der Gesellschaft aufgearbeitet ist, was das alles überhaupt war.
Aber wer Trump verstehen will, muss viel weiter zurückblicken als 2016. Das Konzept der White Supremacy etwa reicht bis in die Gründerzeit, und noch immer sieht man auch in New York eine starke Segregation in den Stadtvierteln. Und Trumps Wirtschaftspolitik atmet den neoliberalen Geist von Ronald Reagan. Der wollte damals zum Beispiel Ketchup zu Gemüse erklären, damit das Schulessen billiger wird, das sagt schon viel aus. In New York ist das Schulessen im Übrigen für Kinder aus obdachlosen Familien oft die einzige richtige Mahlzeit am Tag. Darum wollte der Bürgermeister die Schulen während des Shutdowns zunächst gar nicht schließen. Halten konnte er das aber nicht.
Nach oben gibt es keine Grenze
Janna Nawroth ist Biophysikerin und Bioingenieurin und arbeitet in den Bereichen Gewebemechanik und personalisierte Medizin. Ihre Rückkehr nach Deutschland und den Aufbau einer eigenen Arbeitsgruppe ermöglichen ein ERC Starting Grant und das Professorinnenprogramm der Leibniz-Gemeinschaft.
Die Welt der amerikanischen Unis ist so anders als die Trump-Welt. Mir gefällt die Einstellung der Leute: flache Hierarchien, Optimismus, die Offenheit, jeder eine Chance zu geben, egal welchen Titel sie hat oder woher sie kommt. Ich bin 2005 als kleine Masterstudentin nach Yale gekommen. Dort wurden mir gleich Projekte angeboten, die richtig Kaliber hatten. In Deutschland durfte ich bis dahin nie richtig selbst arbeiten im Labor – das war so langweilig, dass ich lange nicht wusste, ob ich überhaupt Wissenschaftlerin werden will. In den USA hatte ich das Gefühl: Nach oben gibt es keine Grenze.
Klar, ich habe sehr privilegierte Erfahrungen gemacht, an lauter Top-Unis: Master in Yale, Doktorarbeit am Caltech, Postdoc in Harvard, drei Jahre in der Wirtschaft, und seit 2019 bin ich an der University of Southern California. Da gab es überall die Mittel für Spitzenforschung. Das kann aber auch anders aussehen. Wenn man einen Doktoranden mit amerikanischem Abschluss bekommt, dann weiß man oft nicht, was einen erwartet. Die Schulen und auch die Unis sind so unterschiedlich. In Deutschland sind die Abschlüsse von München bis Kiel vergleichbar. Das ist eine große Stärke im deutschen System: eine sehr robuste Ausbildung.
»Die amerikanische Einstellung bringe ich mit: Zuversicht, Kreativität, dieses ›Can Do‹.«
Die Unis in den USA sind sehr bemüht, die Auswirkungen der Politik von Donald Trump abzufedern. Außerhalb des Uni-Kosmos wird aber schnell klar: Der American Dream war schon immer nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung erreichbar. Ich habe mich in den letzten Jahren viel beschäftigt mit Konflikten in der US-Gesellschaft, mit Rassismus, Diskriminierung von Minderheiten. Meine Partnerin ist Afroamerikanerin, das hat mich inspiriert, mich mit der Geschichte der Sklaverei zu beschäftigen. Ein großer Teil der Gesellschaft verleugnet schlichtweg deren immer noch enorme Auswirkungen, und in den Schulen wird dieses Kapitel kaum aufgearbeitet. Das hat mich schockiert.
Die meisten meiner Kolleginnen hier sind sehr liberal eingestellt und eher negativ gegenüber Trump. Man stößt selten auf die andere Seite. Ich habe aber auch ein paar sehr konservative Freunde. Da ist klar: Wir sprechen nicht über Politik. Weil es einfach keinen Mittelweg gibt.
Dass ich jetzt nach Deutschland zurückkehre, hat rein private Gründe – vor allem die Familie. Seit mehreren Jahren habe ich auf den richtigen Moment und die richtige Stelle gewartet. Jetzt hat es geklappt – ich habe zwei Forschungsstipendien über je 1,5 Millionen Euro bekommen. Damit kann ich meine eigene Forschungsgruppe aufbauen. Meine Partnerin werde ich mitbringen – und auch die amerikanische Einstellung: die Zuversicht, die Kreativität, dieses »Can Do«. Und vielleicht gehe ich irgendwann wieder zurück in die USA.
Erschienen am 03. November 2020
Inhalt
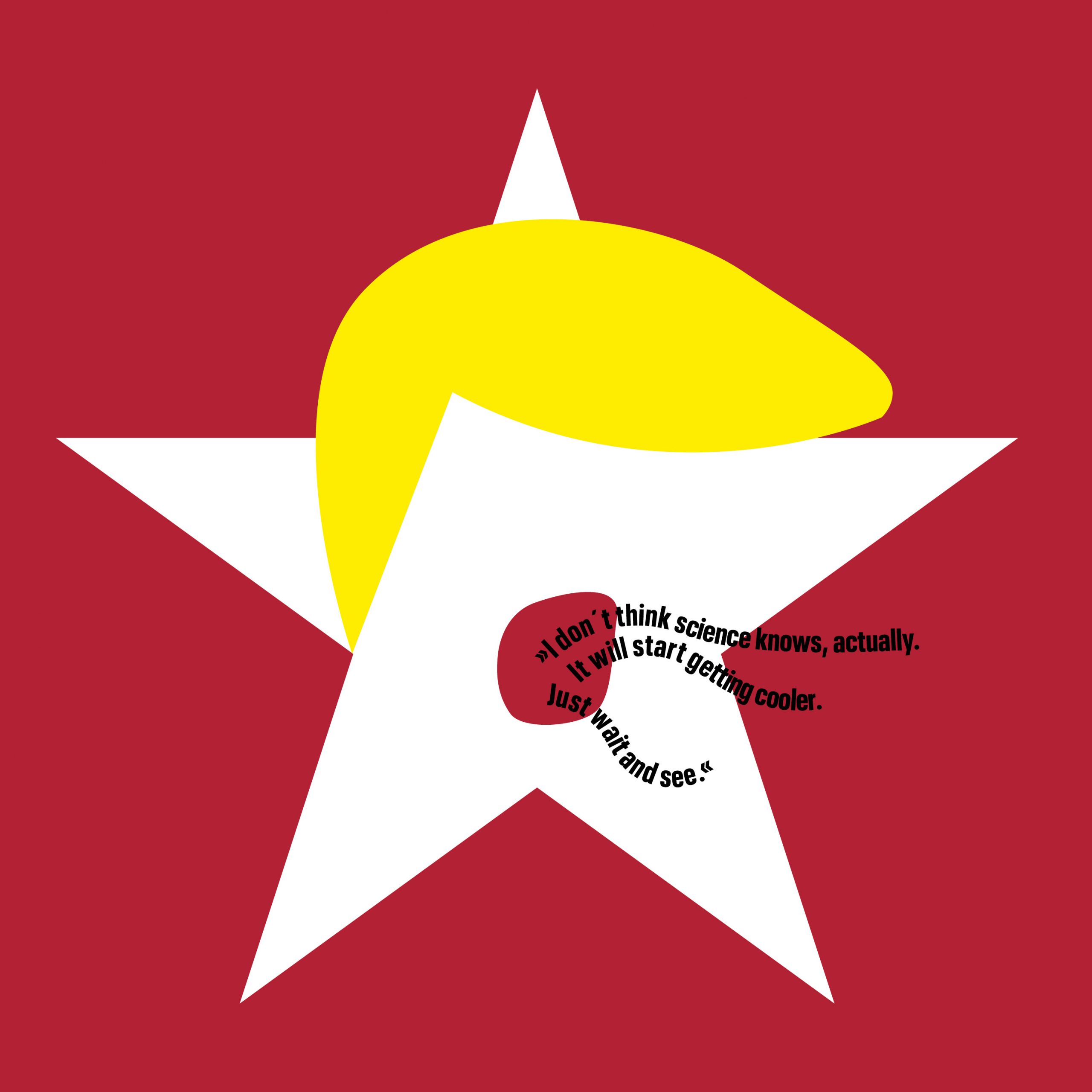
I don`t think science knows
Was wir von Donald Trump über das komplexe Verhältnis von Wissenschaft und Politik lernen konnten

Im Land der unbegrenzten Wahrheiten
Vor vier Jahren wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt – was bedeutet das für Menschen, die zum Studieren und Forschen in die USA gingen? Und was erhoffen sie sich von dieser Wahl? Fünf Erzählungen.
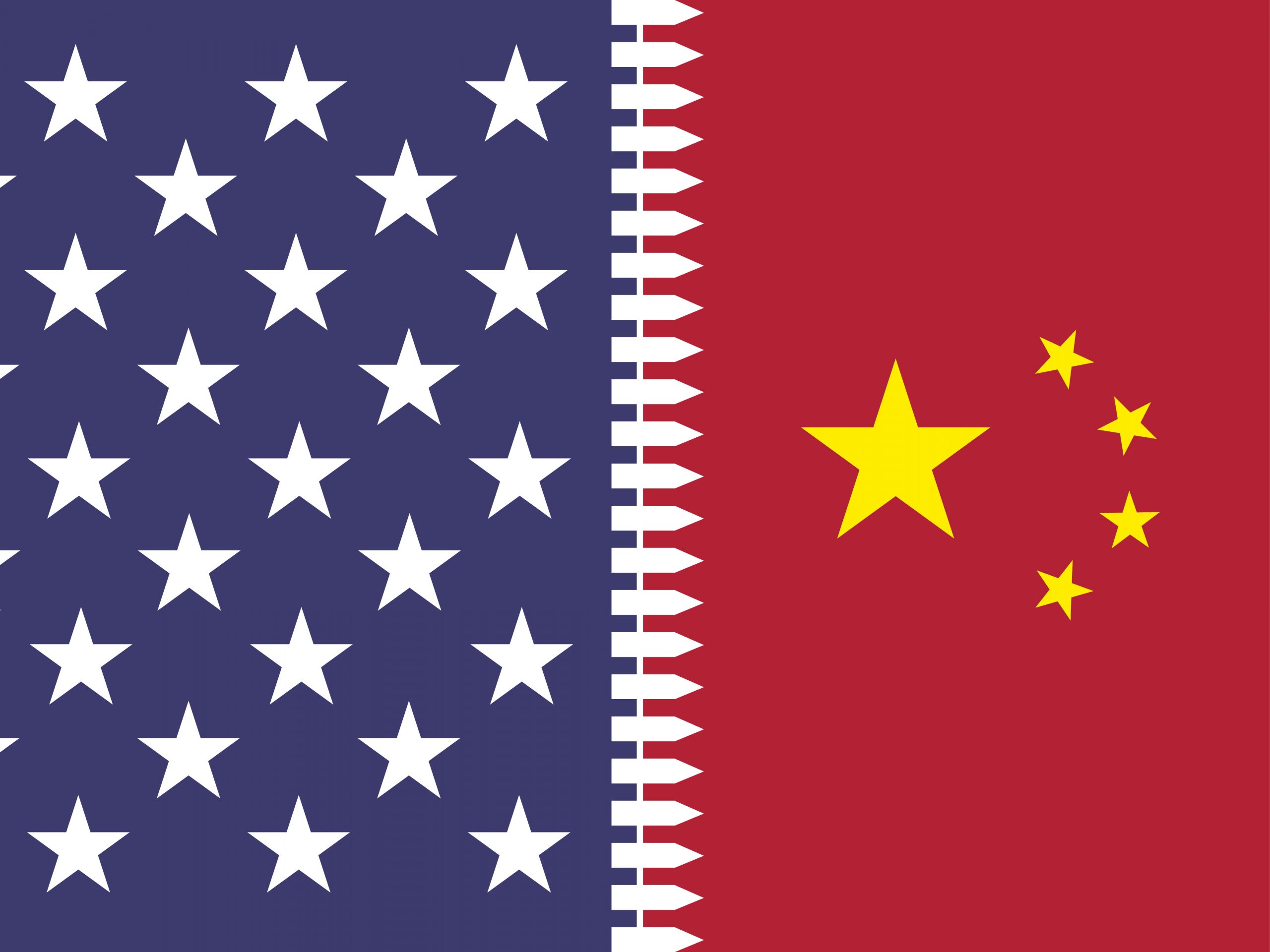
Schlaue Amerikaner gehen nicht in die Wissenschaft
Thomas Südhof ging 1983 zum ersten Mal in die USA, um als Postdoktorand zu arbeiten. Heute ist der Nobelpreisträger zunehmend irritiert von der amerikanischen Gesellschaft. Ein Interview.

Im Leuchtturm gehen die Lichter aus
Wie blicken deutsche Wissenschaftler*innen auf ihren Aufenthalt in den USA zurück? Wie blicken sie den Wahlen entgegen? Und was werden sie vermissen an den USA? Drei Forschende erzählen.
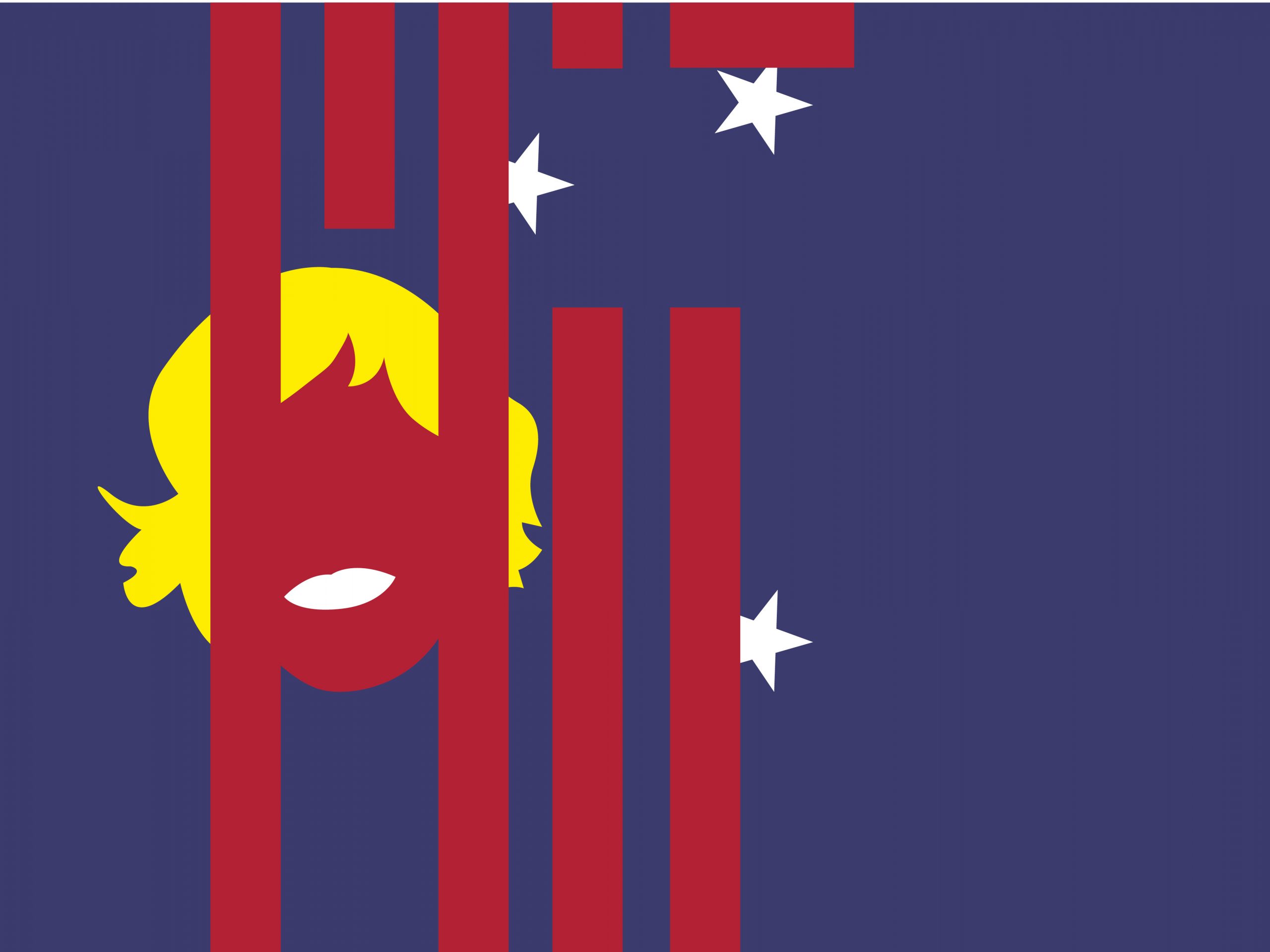
Meditieren gegen Trump
Die Journalistin Eva Wolfangel verbrachte ein Jahr als Stipendiatin in den USA. Um die Realität unter Trump auszuhalten, braucht es kreative Mittel, beobachtete sie. Ein surrealer Reisebericht.
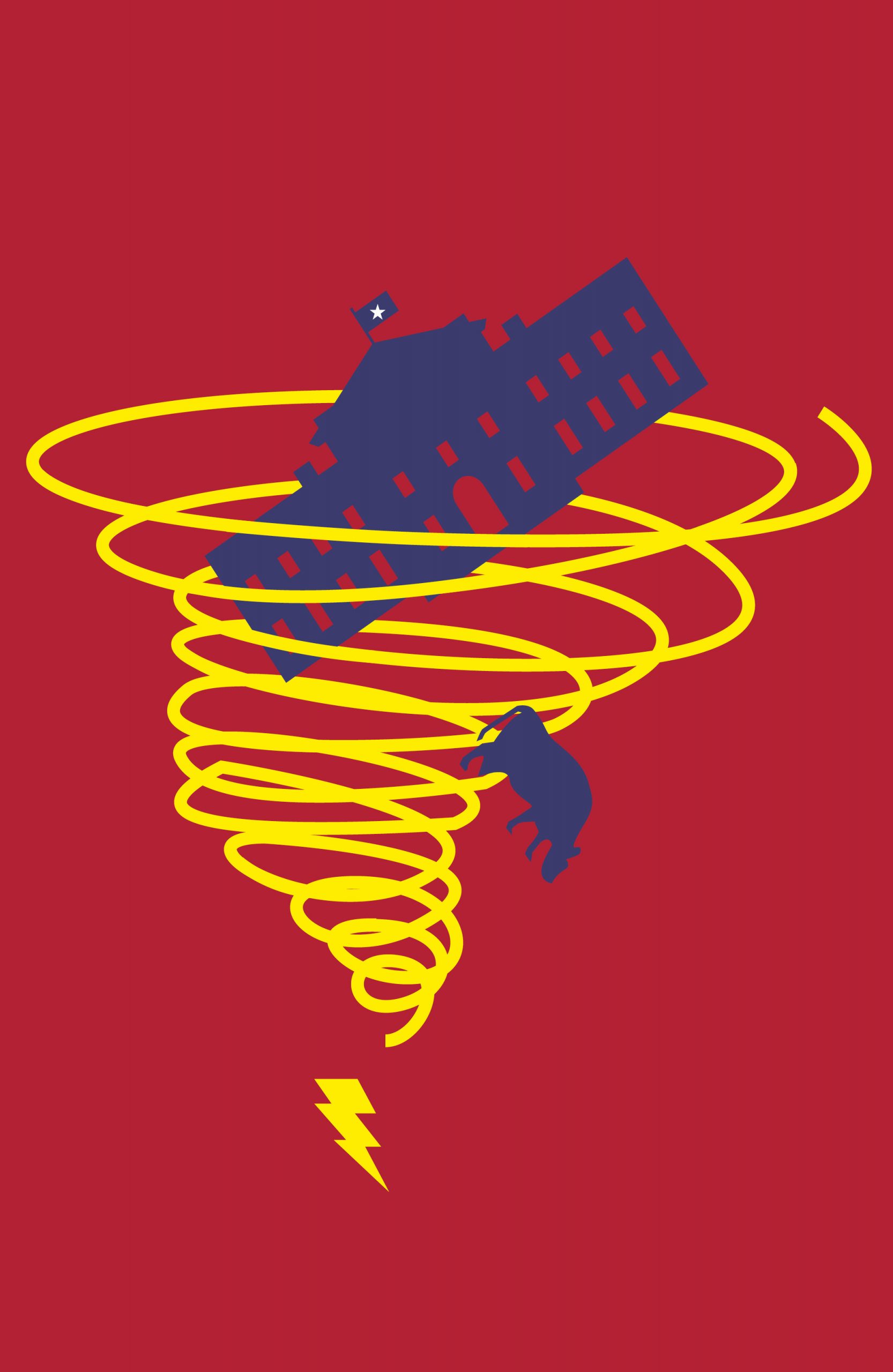
Der Sturmbeobachter
Mit zwei Jahren Verspätung wird Kelvin K. Droegemeier vereidigt als erster wissenschaftlicher Berater von Donald Trump. Wer ist dieser Mann? Versuch einer Annäherung.
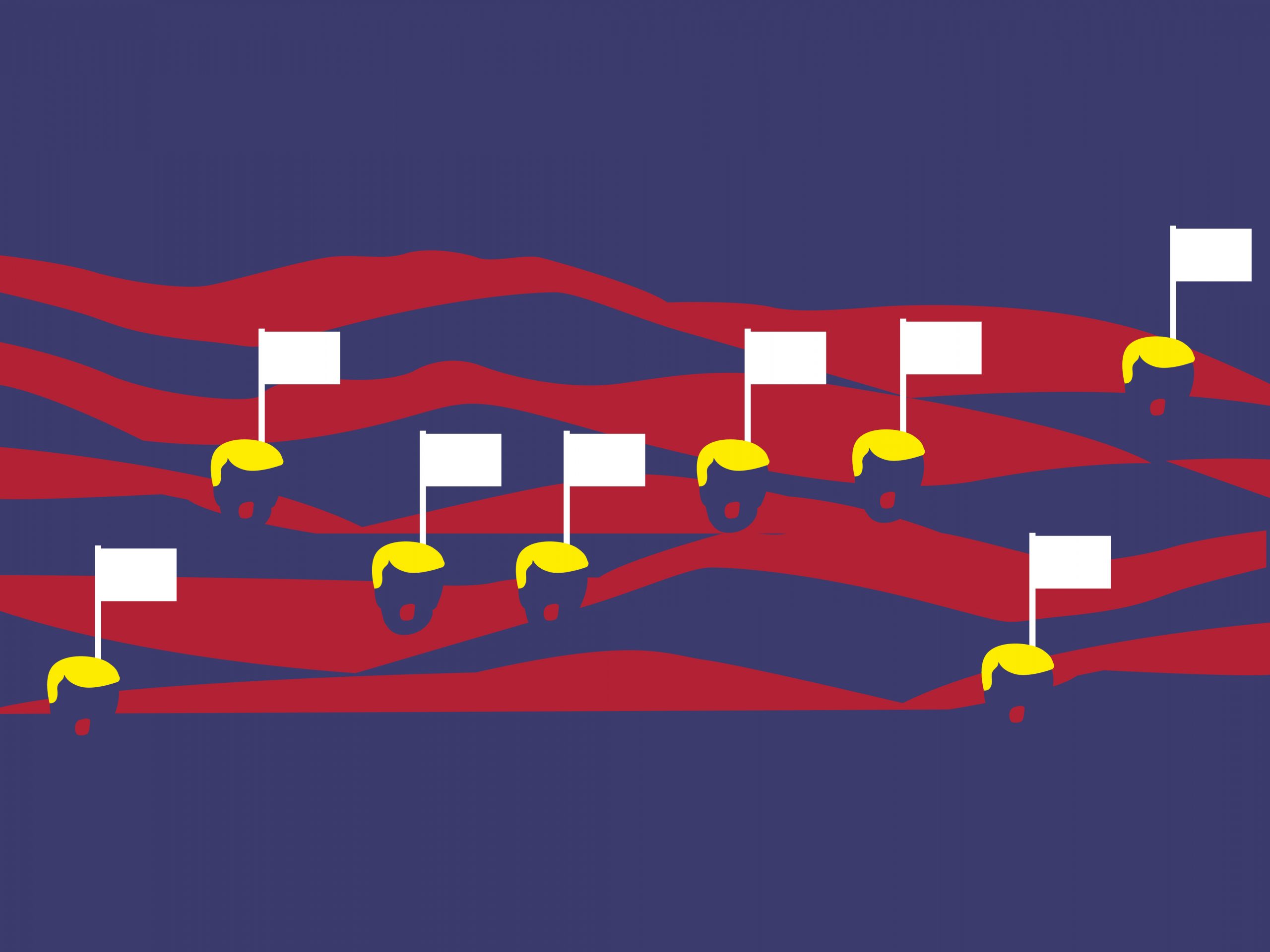
Affen auf Koks
Trump tanzt, während die Popmusik auf die Barrikaden geht: Wenn sich Politik zum Pop-Zirkus wandelt, werden Popstars plötzlich politisch.