Die Journalistin Eva Wolfangel verbrachte ein Jahr als Stipendiatin in den USA. Um die Realität unter Trump auszuhalten, braucht es kreative Mittel, beobachtete sie. Ein surrealer Reisebericht.
Ich habe mich noch nie und nirgendwo so wenig willkommen gefühlt. An einem frühen Morgen im Sommer 2019 stehe ich mit der ganzen Familie in der Schlange des US-Konsulats in München. Wir haben einen Termin! Das hatte ich kaum noch erwartet. Denn in den Wochen zuvor ließen die US-Behörden keinen Zweifel daran, dass wir als Einreisewillige erstens verdächtig, zweitens Bittsteller und drittens nicht willkommen sind.
Das Misstrauen spricht schon aus den seitenlangen Online-Formularen, in denen wir alle unsere Social-Media-Accounts offenlegen und für jeden einzelnen – auch für jedes Kind – seitenweise Fragen beantworten mussten: Hat das Kind schon einen Völkermord begangen? Hängt es terroristischem Gedankengut an? Dann stellt sich heraus: Für uns fünf gibt es in den kommenden acht Wochen keinen Konsulatstermin – doch da beginnt das Fellowship schon, zu dem ich eingeladen bin. Eilantrag: abgelehnt. Telefonnummern der Zuständigen: selbst für eine Journalistin schwer in Erfahrung zu bringen. Und am Telefon: nur Unfreundlichkeit. »Wir können nichts machen.« »Sie sollten Ihren Flug erstmal canceln.« Die knapp 1.000 Euro Visumsantragsgebühr sind freilich schon lange abgebucht. Ob der Antrag denn wahrscheinlich durchgeht? »Das weiß keiner.« Da hilft auch die offizielle Einladung als Knight Science Journalism Fellow des Massachusetts Institute of Technology (MIT) nichts, einer der Eliteuniversitäten, auf die man in den Staaten so stolz ist. Eigentlich.

Denn US-Präsident Trump hat in den wenigen Jahren seiner Herrschaft ein Klima geschaffen, in dem die Wissenschaft selbst zum Bittsteller abgestempelt wird: Er hat Forschungsgelder gekürzt, Universitäten diskreditiert und versucht, den Einfluss wissenschaftlicher Erkenntnis auf die Gesetzgebung so weit wie möglich zu dezimieren. Besonders hart getroffen hat die Wissenschaft auch der sogenannte Travel Ban, eine Executive Order, mit der Trump bereits in seiner zweiten Regierungswoche die Einreise von Bürgern aus sieben muslimischen Staaten untersagte.
»Hat das Kind schon
einen Völkermord begangen?«
Als ich in dieser Schlange am Konsulat stehe und die vergangenen Wochen Revue passieren lasse, muss ich an eine Geschichte denken, die ich zu Beginn von Trumps Amtszeit recherchiert hatte. Ich hatte Forscherinnen und Forscher in Deutschland befragt, die vom Travel Ban betroffen waren. Ehrgeizige junge Menschen, die endlich die ersehnte Doktorandenstelle an einer US-Universität ergattert hatten oder ihren ersten Job bei einem Start-up – und die nun auf einmal den »falschen Pass« hatten, weil darauf Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien oder Jemen stand. Die realisieren mussten, dass die US-Politik anscheinend ein Mitspracherecht hatte in ihren Plänen. Manchen kamen die Tränen. Niemand konnte ihnen helfen.
Wir haben eigentlich nichts zu befürchten. Wir haben den »richtigen« Pass und die »richtige« Religion. »Sie müssen aber unbedingt nachweisen, dass Sie wieder ausreisen«, sagt einer der Mitarbeiter, der für nichts zuständig sein will. Also haben wir Schreiben von Schule, Arbeitgeber und Familie dabei, die bestätigen, dass wir dringend zurückerwartet werden nach einem Jahr.
Ich fahre nach München, um das Visum und unsere Pässe abzuholen – wenige Tage vor unserer Abreise. Nur um sicherzustellen, dass nicht irgendetwas auf dem Postweg verloren geht. Als wir am fünften August am Flughafen in Boston ankommen, sind wir nervös. Ich habe von Journalisten gelesen, die bei der Einreise stundenlang festgehalten wurden, bis sie ihre Computer-Passwörter hergaben und die Beamten die gesamte Festplatte kopiert hatten. Das ist unrechtmäßig, doch es wurde ihnen verweigert, einen Anwalt zu kontaktieren. Ohne dass überhaupt jemand davon wusste, wurden sie so lange festgehalten bis sie aufgaben. »Nur keine Witze machen«, schärfen wir den Kindern ein. Immer freundlich bleiben, nehme ich mir vor. Aber dann: gar nichts. Ein Stempel, und wir werden durchgewunken. Niemand möchte die Unterlagen sehen, die belegen, dass wir in einem Jahr in Deutschland zurückerwartet werden.
In diesem Jahr in den USA treffe ich viele Menschen, die uns auf diesem Rückweg gerne begleiten würden. Schon als wir uns bei den neuen Nachbarn in Cambridge vorstellen, hören wir Dinge wie: »Ihr kommt aus Deutschland – nehmt ihr mich mit zurück?« Oder: »Ihr habt so eine wunderbare Kanzlerin, wie habt ihr das nur gemacht?« Über die Monate hinweg wird mir klar, was wir an unserer Heimat haben. Dinge, die uns bisher selbstverständlich erschienen, werden im Alltag unter der Trump-Regierung besonders. Denn hier leben die Menschen mit einem Präsidenten, der alle paar Tage Falschnachrichten oder Hetze auf Twitter postet. Mit einem Gesundheitssystem, das Menschen einfach fallen lässt. Und mit existenziellen Ängsten: Arbeitnehmer bangen um ihren Job, wenn sie sich für ein paar Tage krankmelden – und diese Tage werden vom Urlaub abgezogen.
»Es gibt sie noch: Die Hoffnung,
dass nach der Wahl alles besser wird.«
Während meines Fellowship bin ich beeindruckt, wie oft Deutschland und Europa etwa in den Seminaren der Harvard Kennedy School als positive Beispiele genannt werden – sei es für Datenschutz oder für ein funktionierendes Sozialsystem. Der eigene Präsident wird hier selten laut, aber eigentlich immerzu indirekt kritisiert. Augen rollen. Bedeutsames Schweigen, wenn sein Name fällt. Es ziemt sich nicht, öffentlich zu lästern, vielleicht schwingt ein wenig Angst mit. Vor allem aber braucht man es nicht auszusprechen: Die Realität unter Trump ist schwer auszuhalten. Doch es gibt sie noch: Die Hoffnung, dass nach der Wahl im November alles besser wird. Aber sie ist brüchig. Immer mehr Forscherinnen, die ich treffe, und Kollegen im Fellowship fragen interessiert, ob es nicht Möglichkeiten gebe, in Deutschland einen Job zu finden.
Meditieren gegen Trump
Wie sehr die Menschen in den USA die politische Lage belastet, wird mir an einem Ort klar, an dem ich am wenigsten damit gerechnet habe: im Cambridge Insight Meditation Center. Der Psychologieprofessor Larry Rosenberg aus Harvard hat es 1985 gegründet mit der Idee, dass Meditation nicht nur im abgelegenen Retreat-Zentrum in der Natur möglich sein sollte, sondern dass sich die Praxis mit dem Alltag verbinden lassen sollte. Das Zentrum ist wunderbar. Doch irgendwann merke ich, dass sich meine Interessen und die der anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen voneinander entfernen. Drehten sich im Herbst 2019 die Themen um »Dankbarkeit« oder »Großzügigkeit«, lauten sie ab 2020 immer häufiger: »Mit dem Stress vor der Wahl zurechtkommen«, es geht um Depressionen, die aufgrund der politischen Lage in den USA entstehen. Heute heißen die Programme »Election Sanity« oder »Equanimity Before, During and After the Election«. Der US-Präsident wird zur psychischen Belastungsprobe für seine Bürger.
Am Ende geht alles ganz schnell. Im März sperrt uns das MIT aus, auch Harvard schickt alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Homeoffice und die Studierenden »nach Hause«. Damit sind nicht die Wohnheime auf dem Campus gemeint, sondern ein Zuhause, das möglichst weit weg ist von Cambridge, damit die Uni keinen Ärger mit Corona-Erkrankungen der Studierenden hat. Unsere Seminare finden von einem auf den anderen Tag auf Zoom statt.
»Was der Staat in den USA verbockt, wird privat geflickt.«
Nur die Kinder dürfen noch etwas länger zur Schule gehen. Wir bekommen zahlreiche E-Mails vom Superintendanten der Cambridge Public Schools, die rechtfertigen, wieso Schulen so lange wie möglich geöffnet bleiben sollen. Denn auch wenn die Hauptaufgabe der Schulen die Bildung sei, hingen von ihnen auch die Ernährung und das psychische Wohlergehen hunderter Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Familien ab. Als sie dann doch schließen – eigentlich zunächst für 14 Tage, doch sie haben bis heute nicht wieder geöffnet – läuft ein großes Programm an, in dem Freiwillige Essen an bedürftige Familien verteilen. Auch ich packe unseren Fahrradanhänger voll mit gespendetem Essen der Organisation Food for Free und arbeite eine lange Liste von Adressen ab. Ich lerne eine ganz andere Seite des berühmten Cambridge kennen. Sogar hier wird die soziale Ungleichheit deutlich. Mir wird klar: Was der Staat in den USA verbockt, wird privat geflickt.
Trump mischt sich wieder in die Visapolitik ein und versucht zu unterbinden, dass Studierende im Land bleiben können, wenn sie nur Onlinekurse besuchen. Ich verfolge die Debatte auf Twitter und sehe die Verbitterung und Verzweiflung auch von Uni-Mitarbeitern und Professorinnen, die nicht in den USA geboren sind und sich seit Jahren abhängig fühlen von einer Willkür, die ihnen keine Planung erlaubt.
Gehen oder bleiben?
Angesichts der Corona-Krise macht sich Panik breit, auch unter uns internationalen Fellows. Gerüchte machen die Runde, dass bald keine Flüge mehr aus Amerika führen. Wer jetzt nicht fliegt, muss womöglich auf unbestimmte Zeit bleiben. Das will keiner. Als erste verschwindet meine Mit-Stipendiatin aus Indien. Sie erwischt einen der letzten Flüge nach Delhi. Dann der Kollege aus Brasilien. Beide hatten ursprünglich mit dem Gedanken gespielt, länger in den USA zu bleiben, schließlich sind weder Indien noch Brasilien berühmt für die Pressefreiheit. Als kritische Geister leben sie potentiell gefährlich. Aber in den USA zu bleiben unter Trump – das ist noch weniger attraktiv.
Gehen oder bleiben? Auch für meine US-Kolleginnen und Kollegen ist die Frage drängend: Sie haben keinerlei Kündigungsschutz. Die meisten haben ohnehin nur eine mündliche Vereinbarung, dass sie in ihren Job zurück können nach ihrem Fellowship-Jahr. Doch die ist nichts wert. »Viele Medien werden eingehen«, sagen sie. Erst Trumps Hasstiraden auf die »Lügenpresse«, jetzt die Wirtschaftskrise durch Corona. »Wenn ich jetzt nicht zurückgehe, bin ich draußen.« Einer kündigt das Fellowship verfrüht und verzichtet auf einen Teil des Stipendiums, um für weniger Geld in seiner Redaktion zu arbeiten. Hauptsache, die Zukunft ist vorerst gesichert.
»Wir sitzen in der Wohnung, die Computer quäken um die Wette. Draußen passieren krasse Dinge.«
Wir bleiben – auch weil die Situation an den Flughäfen unsäglich ist. Freunde und Kolleginnen, die in dieser Zeit abreisen, schicken Fotos von völlig überfüllten Flughäfen. Flüge werden gestrichen, aber die Reisenden nicht informiert. Airlines sind nicht erreichbar. Viele Menschen stranden für Stunden oder Tage in Transitbereichen. Wir bleiben und hoffen, dass es sich irgendwann entspannt. Das Fellowship geht per Zoom weiter, ebenso die Schule der Kinder. Wir sitzen in unserer kleinen Wohnung, und die Computer quäken um die Wette. Draußen passieren krasse Dinge.
Im März verbietet Trump vom einen auf den anderen Tag die Einreise aus Europa und Großbritannien. Im April behauptet Trump, man müsse Desinfektionsmittel trinken, um sich innerlich vom Coronavirus zu befreien. Die Kinder rollen mit den Augen, als wir ihnen davon erzählen. Einige US-Bürger trinken daraufhin in der Tat Desinfektionsmittel, mindestens vier sterben daran.
Am 25. Mai wird der Afroamerikaner George Floyd bei einer Polizeikontrolle ermordet. In Boston gibt es wie in vielen Städten der USA große Protestzüge und Ausschreitungen. Über Tage gibt es in den Nachrichten kaum ein anderes Thema. Es häufen sich Berichte über Todesfälle in Polizeigewahrsam und bei Personenüberprüfungen.
Demonstrierende belagern das Weiße Haus. Der Präsident wird zeitweise in einen Bunker gebracht, aus Sicherheitsgründen, heißt es. Verschwörungstheorien machen die Runde, und ich spüre, wie die US-Kollegen kämpfen, um diese zu entkräften. Sie haben keine Chance. Unter ihren Tweets von den Protesten sammeln sich Kommentare von Rechten und Verschwörungstheoretikern.
»Ihr habt eine Wahl«, schreibt uns die Schule und fordert uns auf, uns mit der rassistischen Gewalt zu beschäftigen, den Kindern von den Morden an Schwarzen zu erzählen und gemeinsam Stellung zu beziehen. Beispielsweise in Form von Kreide-Parolen auf der Straße. Afroamerikanische Familien hätten nämlich keine Wahl, schreibt die Schule weiter. Für sie seien die Gewalt und der Rassismus ein tägliches, traumatisierendes Thema. Deshalb sei es wichtig, dass alle zusammenhalten. Dass die Kinder für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler einstehen. Wir malen Parolen und sprechen über Gewalt. Die Kinder sind fassungslos.
»2020 hat das Potential, ein eigenes Seminar zu bekommen.«
Trump postet derweil ein »Gedenkvideo« an George Floyd auf Twitter, das gewalttätige Ausschreitungen zeigt. Twitter löscht das Video wegen Urheberrechtsverletzungen. Kurz zuvor hatte Twitter einen seiner Posts zur Wahl mit Warnhinweisen versehen, da sie »potenziell irreführende Informationen über Wahlprozesse» enthielten. Der Präsident erließ postwendend ein Dekret, nach dem soziale Medien stärker von der Regierung eingeschränkt werden können. Er drohte gar, Twitter zu verbieten.
Eines der letzten Gespräche im Juni 2020 in den USA führe ich mit einem Harvard-Geschichtsprofessor. Das einzige Highlight, sagt er, sei, dass 2020 wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingehe. Bislang gebe es nur zwei Seminare der neueren Geschichte in Harvard, die als Namen lediglich eine Jahreszahl tragen: 1945 und 1968. Beides bedeutende Jahre, in denen sich die Welt dramatisch verändert hat. 2020, sagt er, habe das Potential, ein eigenes Seminar zu bekommen.
Erschienen am 03. November 2020
Inhalt
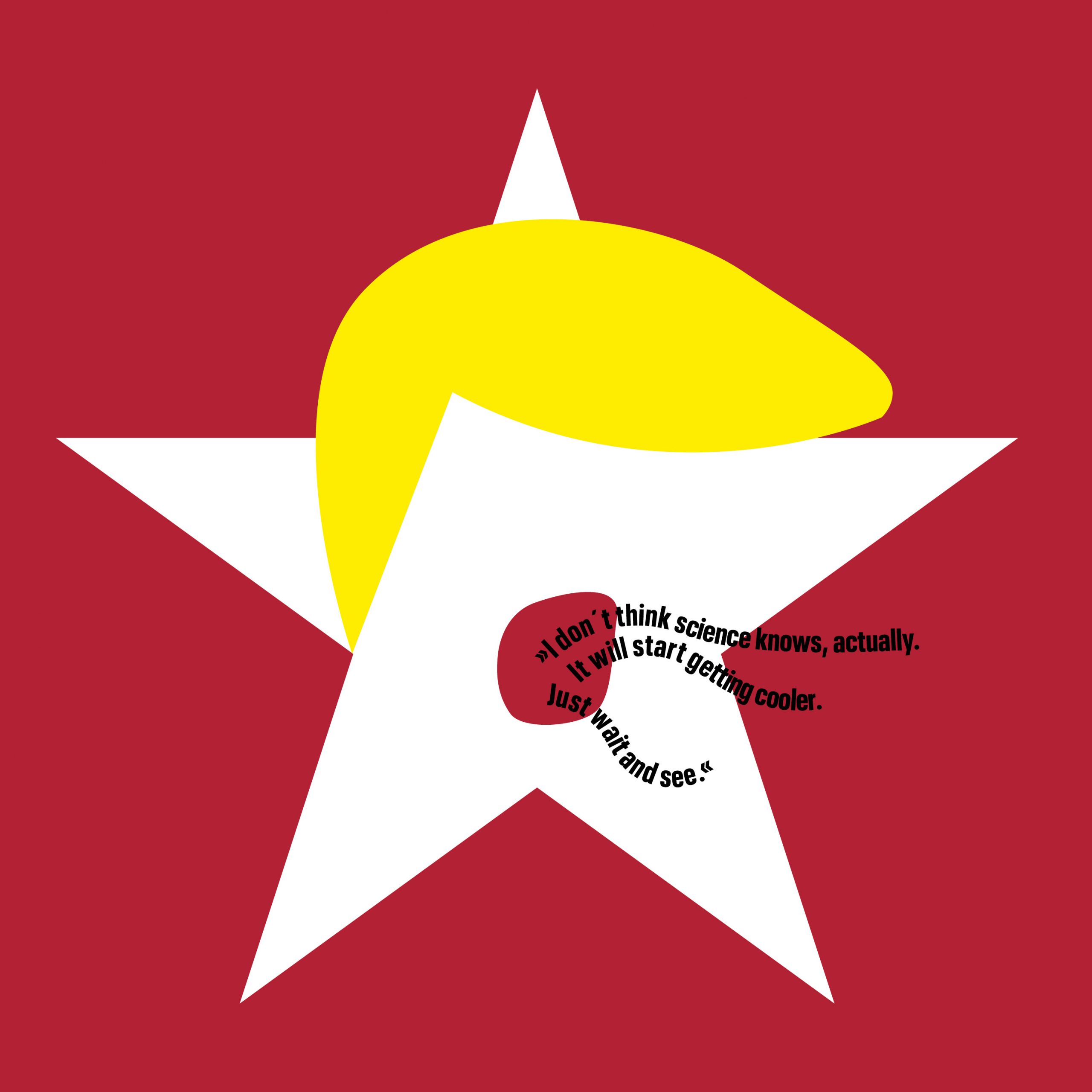
I don`t think science knows
Was wir von Donald Trump über das komplexe Verhältnis von Wissenschaft und Politik lernen konnten

Im Land der unbegrenzten Wahrheiten
Vor vier Jahren wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt – was bedeutet das für Menschen, die zum Studieren und Forschen in die USA gingen? Und was erhoffen sie sich von dieser Wahl? Fünf Erzählungen.
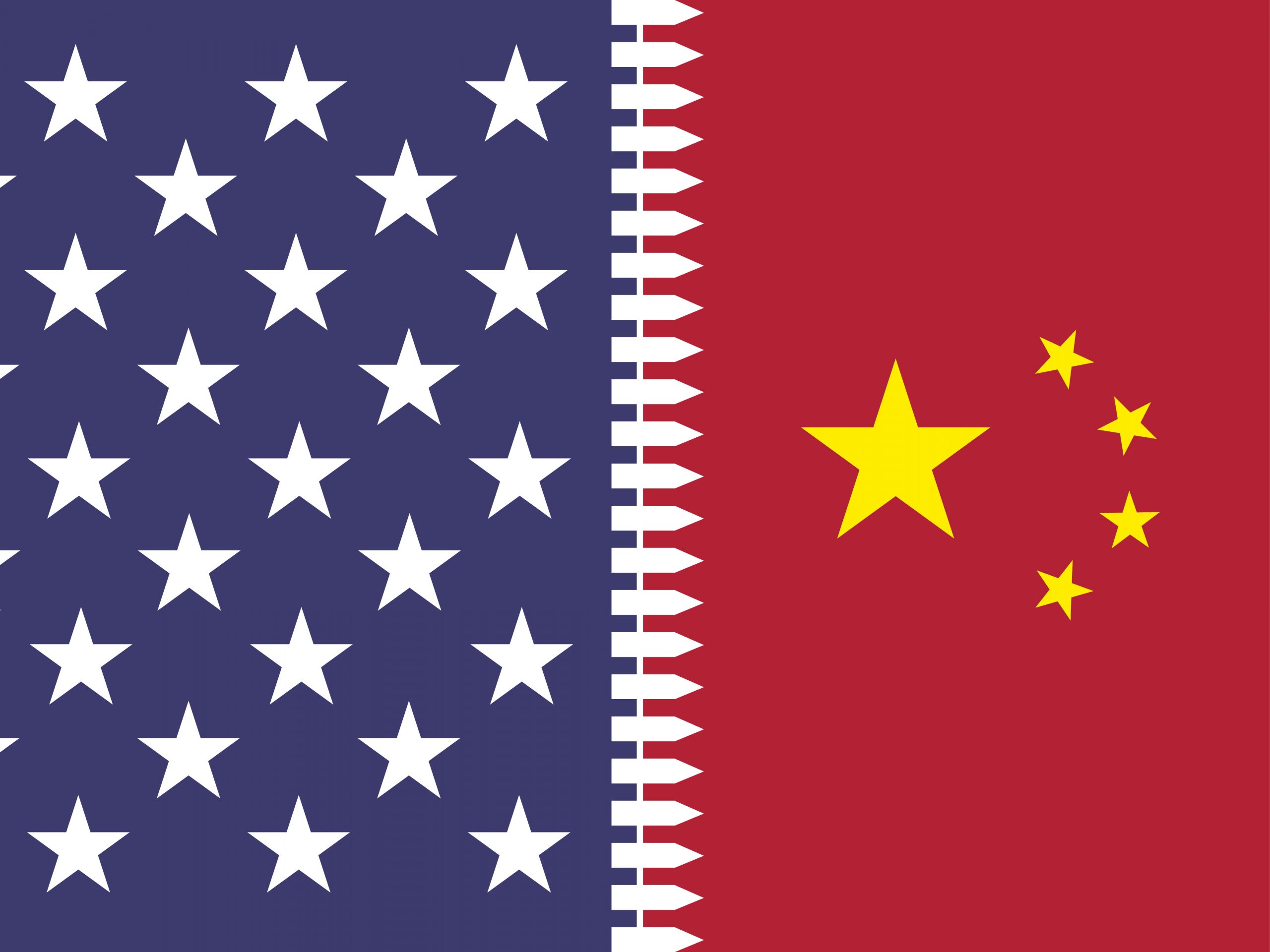
Schlaue Amerikaner gehen nicht in die Wissenschaft
Thomas Südhof ging 1983 zum ersten Mal in die USA, um als Postdoktorand zu arbeiten. Heute ist der Nobelpreisträger zunehmend irritiert von der amerikanischen Gesellschaft. Ein Interview.

Im Leuchtturm gehen die Lichter aus
Wie blicken deutsche Wissenschaftler*innen auf ihren Aufenthalt in den USA zurück? Wie blicken sie den Wahlen entgegen? Und was werden sie vermissen an den USA? Drei Forschende erzählen.
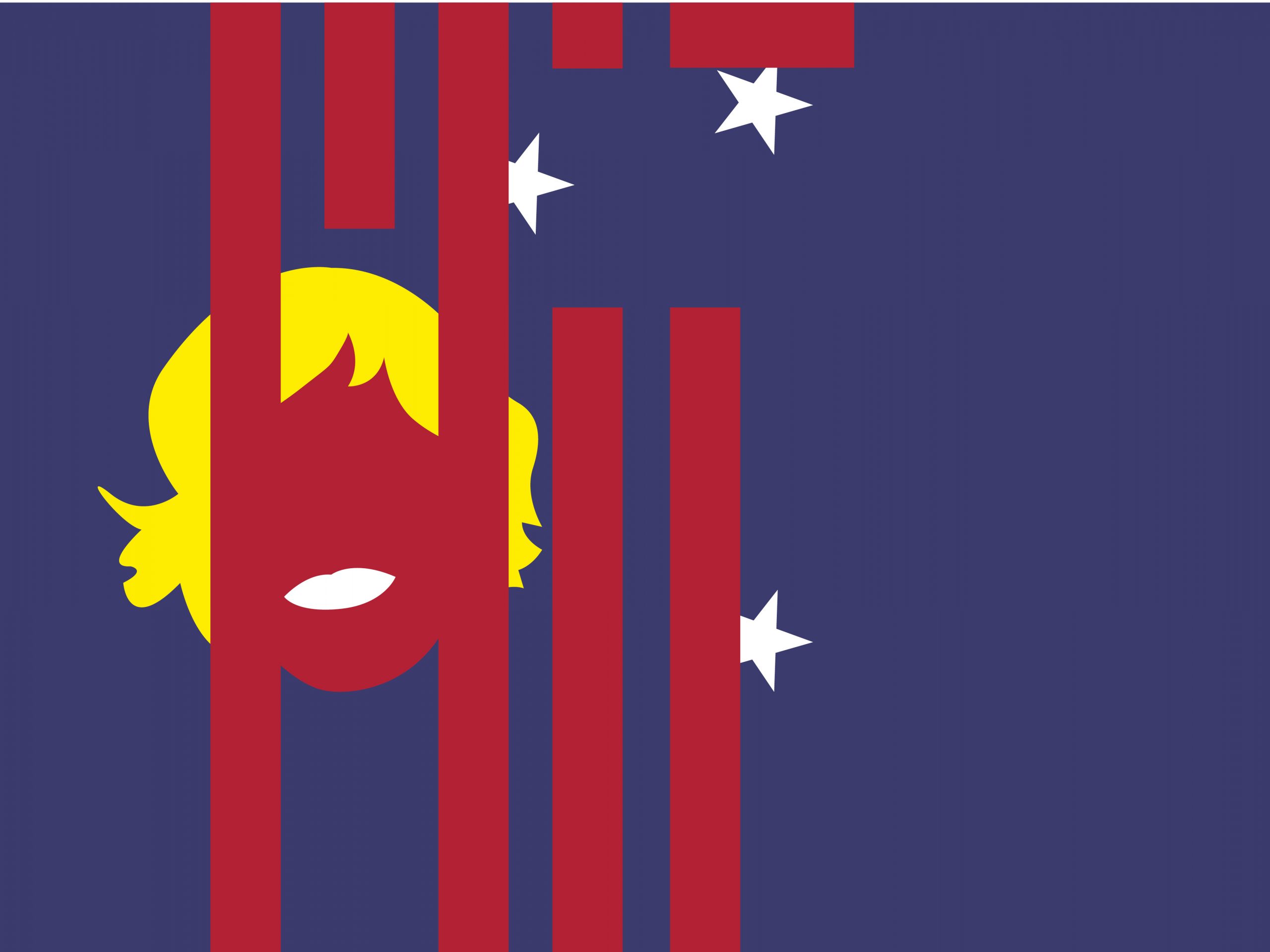
Meditieren gegen Trump
Die Journalistin Eva Wolfangel verbrachte ein Jahr als Stipendiatin in den USA. Um die Realität unter Trump auszuhalten, braucht es kreative Mittel, beobachtete sie. Ein surrealer Reisebericht.
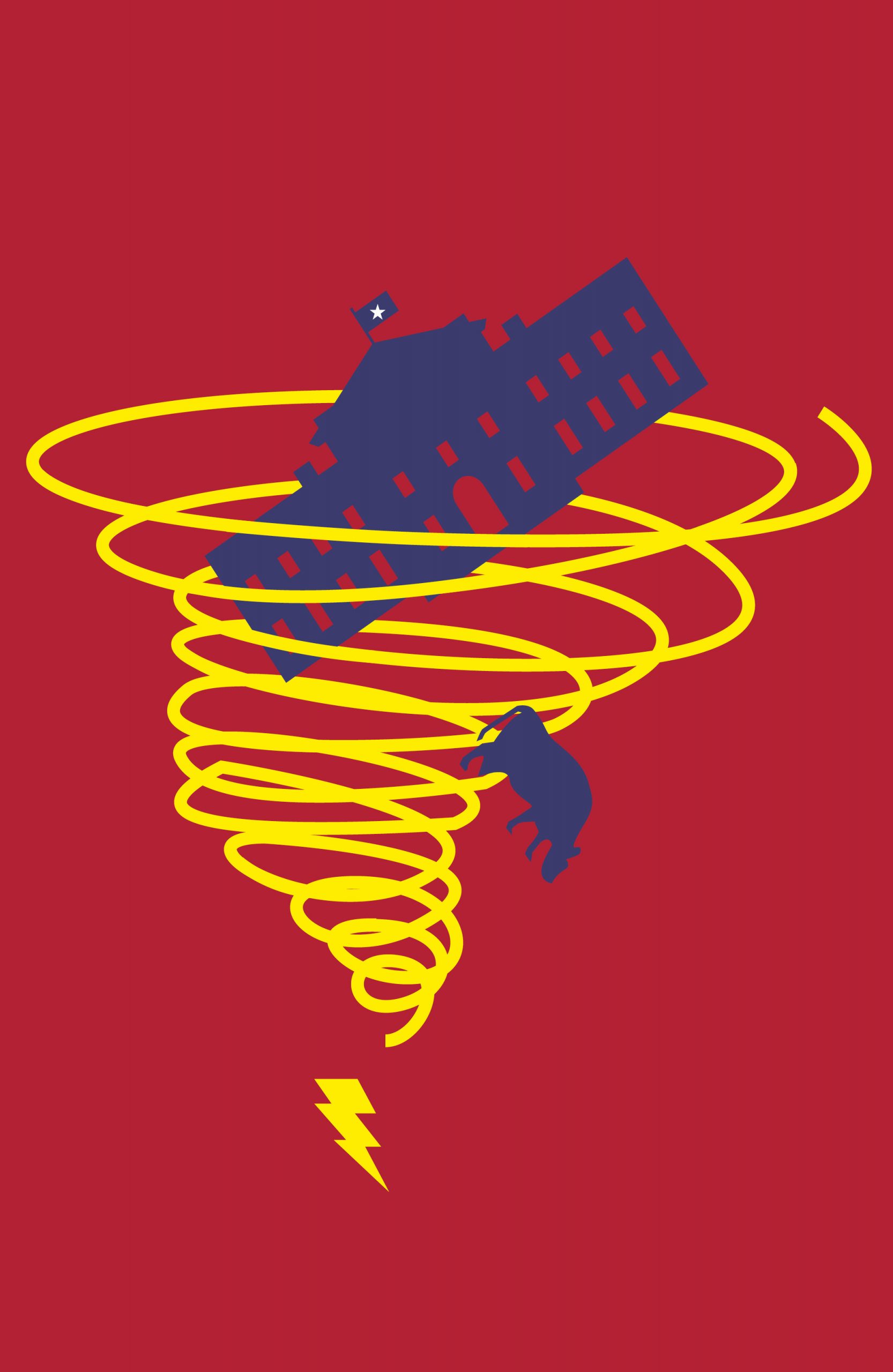
Der Sturmbeobachter
Mit zwei Jahren Verspätung wird Kelvin K. Droegemeier vereidigt als erster wissenschaftlicher Berater von Donald Trump. Wer ist dieser Mann? Versuch einer Annäherung.
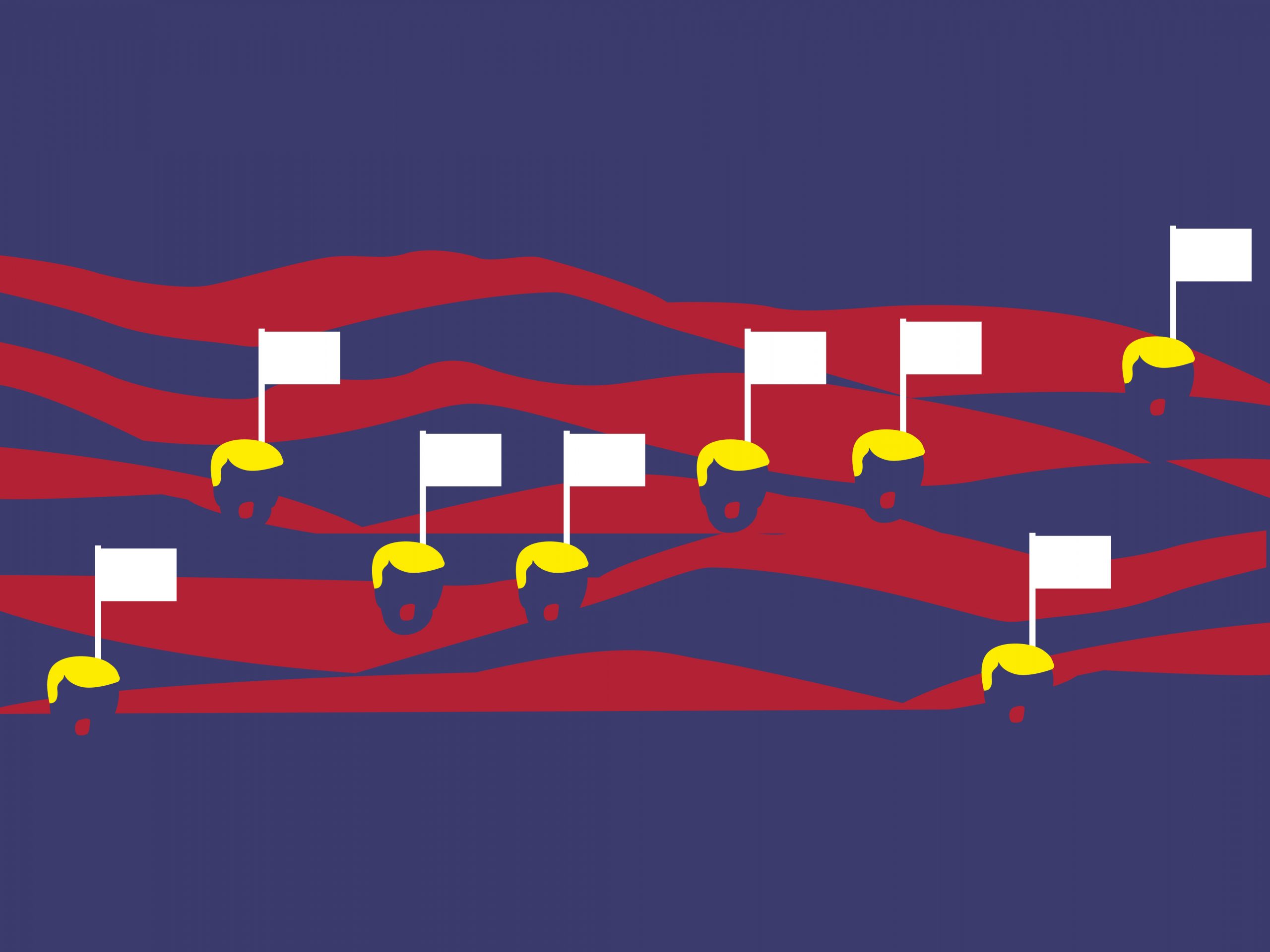
Affen auf Koks
Trump tanzt, während die Popmusik auf die Barrikaden geht: Wenn sich Politik zum Pop-Zirkus wandelt, werden Popstars plötzlich politisch.