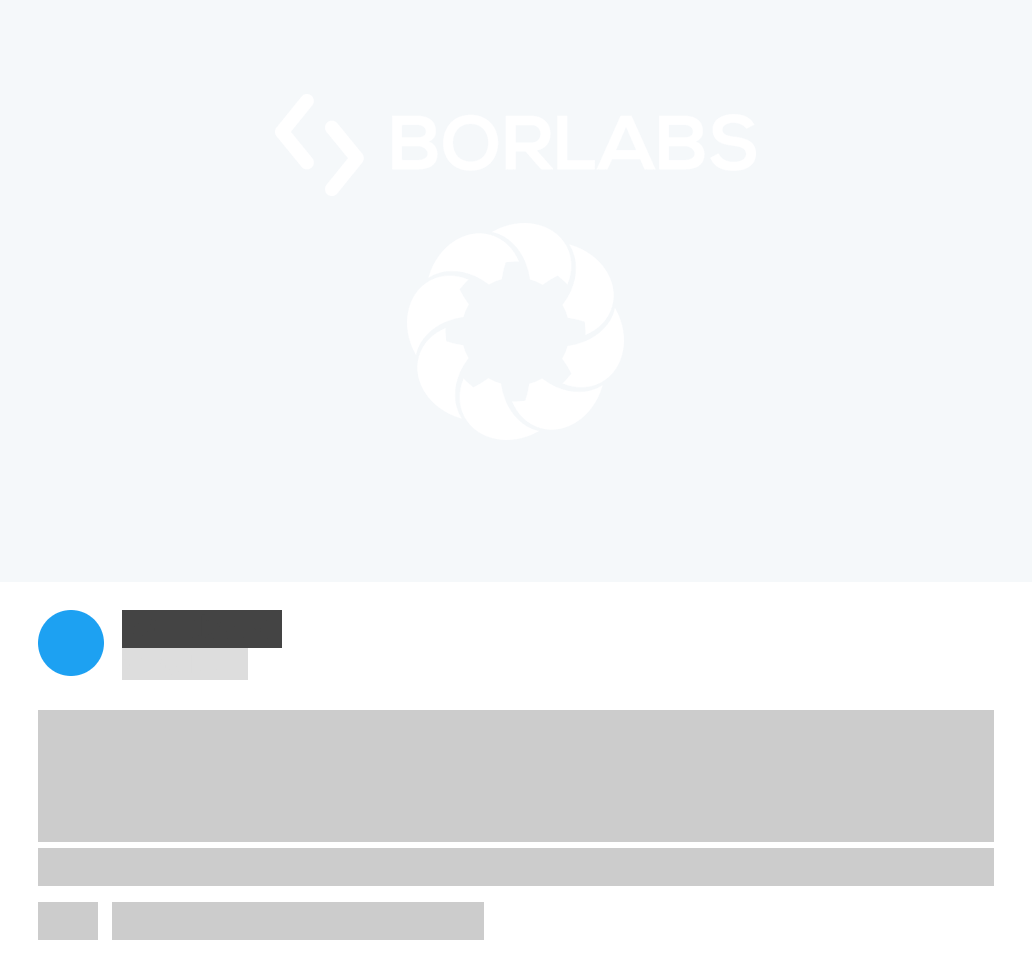Trump tanzt, während die Popmusik auf die Barrikaden geht: Wenn sich Politik zum Pop-Zirkus wandelt, werden Popstars plötzlich politisch.
Der Applaus ersäuft in einer blechern aus den Lautsprechern erschallenden Bläserfanfare und dem stampfenden Beat. Der Mann mit der immer etwas zu lang gebundenen roten Krawatte fängt an sich zu bewegen. Er streckt die Arme aus, wackelt mit dem Oberkörper, reckt die Faust, klatscht im Takt, aber verfehlt mit den Beinen den Beat. Donald Trump tanzt. Wie er es immer tut in diesem Wahlkampf, am Ende seiner Rallyes. Es ist zum Wegschauen. Oder, weil wir wie in einer medialen Konfrontationstherapie gefangen sind, zum immer wieder hinschauen, kommentieren, protestieren, nachäffen, danebenstellen, remixen. Denn die ungelenken Bewegungen des 45. amerikanischen Präsidenten markieren einen von unzähligen politischen Pop-Momenten, die von und mit, wegen und gegen Donald Trump geschaffen wurden und werden. Das mögliche Ende seiner Amtszeit bietet Gelegenheit, einen Blick auf das Verhältnis von Popmusik und amerikanischer Politik zu werfen – und auf eine Präsidentschaft, welche die Popkultur in grausamer Angstlust fesselte.
»Alles, was er anfasst, ist, in seinen eigenen Worten, unbelievable, best, record-setting.«
Donald Trump ist, so haben es die Kulturwissenschaftler Thomas Hecken und Niels Werber in aufeinanderfolgenden Essays im Pop-Magazin nachdrücklich herausgearbeitet, schon allein deshalb Pop, weil er viel beachtet wird. Und weil er diese Beachtung freilich auch sucht wie die Fliege den Mist. Er ist, ganz im Sinne von Nada Surf, »Popular«: Alles, was er anfasst, ist, in seinen eigenen Worten, unbelievable, best, record-setting, er selbst der charts topper, die number one. Jede Amtshandlung, jede Pressekonferenz, jede belanglose Aussage, jeder Tweet ist qua Amt ein Politikum an sich und wird darum zuverlässig in ein populäres Framing gebracht. In Trump und der Reaktion auf ihn zeigen sich, so Niels Werber, »die Bedingungen der Beachtungserzeugung durch Scores, Charts, Ratings etc.« Und also bietet auch der Trumptanz willkommenen Anlass, sozialmedial über den Präsidenten zu berichten, ihn auszulachen, ihn zu feiern oder ihn nachzuahmen, wie in diesem TikTok-Clip, der Donalds Moves mit »Viva la Swing« unterlegt, einem Mashup von Savages »Wild« und »Viva la vida« von Coldplay.
https://www.tiktok.com/@crisnate0/video/6884437934985055493?sender_device=pc&sender_web_id=6886433039687501318&is_from_webapp=1
Die immense Beachtung auch und besonders durch die Popkultur und Popmusik kam allerdings zumindest in den letzten 40 Jahren einem jeden US-Präsidenten zu: In der Amtszeit des ehemaligen Schauspielers Ronald Reagan forderte Prince »Ronnie Talk to Russia«, Bill Clinton hatte das Saxofon und den Auftritt bei den Simpsons, George W. Bushs Irakkrieg führte unter anderem zum Karriereknick der damals noch Dixie Chicks benannten Country-Band: Als sie ihren Song »Travellin’ Soldier« bei einem Konzert ankündigten und den damaligen Präsidenten kritisierten, wurden sie von zahlreichen Radiosendern aus dem Programm geschmissen. Bush wurden insgesamt einige unschmeichelhafte musikalische Widmungen und Porträts zuteil, ganz unverblümt singt etwa Lily Allen: »Fuck You«.
Mit Barack Obama schließlich wurde der Austausch von Politik und Popkultur reziprok: Die HOPE-Poster aus seinem Wahlkampf, die zahlreichen endorsements und Wahlaufrufe durch Musikerinnen und Musiker wie Beyoncé oder The Roots, ihre Auftritte bei Obamas Inauguration 2008 und spätere Besuche im Weißen Haus, aber auch sein, den gleichnamigen BTS-Song inspirierenden, »Mic Drop« beim Korrespondentendinner 2016 verweisen auf die Beziehung zwischen Präsident und Popkultur. Mit der Präsidentschaft Obamas wurde das Weiße Haus, ein Wahrzeichen der Unterdrückung der Schwarzen, durchlässig für black culture und besonders den Hip Hop, wie Jabbari Weekes auf VICE.com schreibt. Seit 2015 veröffentlicht Obama regelmäßig eigene musikalische Bestenlisten; als ein Favorit hat sich dabei immer wieder Kendrick Lamar erwiesen. Dabei ist besonders Lamars Album »To Pimp A Butterfly« komplex mit dem Vermächtnis Obamas verschränkt, da es mit seinem Schwarz-Weiß-Cover auf Obamas unerfüllte Vision einer post racial society verweist: Auf dem Rasen des Weißen Hauses feiern schwarze Männer, zu ihren Füßen ein weißer Richter mit durchgestrichenen Augen. Und so mag der Schlachtruf »we gon’ be alright«, mit dem die Black-Lives-Matter-Proteste angefeuert werden, auch weiter die Hoffnung anfachen, institutionalisierten Rassismus hinter sich lassen zu können. Die Realität seit 2017 heißt aber Trump – und die hat, zumindest aus Sicht der Popkultur, Konflikte verschärft und zeitgleich zur fortschreitenden Popkulturalisierung der Politik zu einer stärkeren Politisierung der Popkultur beigetragen.
»Trumps Egomanie ist eine dermaßen große Zielscheibe, dass Kritik und Protest immer treffen, gleichzeitig aber abzuperlen scheinen.«
Freilich ist musikalischer Protest und Kritik an den herrschenden Verhältnissen mit den Mitteln des Pop heute weder überraschend noch ungewöhnlich. Dieser Protest lässt sich, je nach Verständnis von populärer Musik, in den USA mindestens bis zum Vietnamkrieg oder gar bis zu Abolitionismus und Unabhängigkeitskrieg zurückverfolgen. Pop-Protest ist mal konkreter und mal abstrakter geraten, aber doch häufig klar formuliert in ikonischen Tracks der Gegenkultur wie Billie Holidays »Strange Fruit«, in »Fortunate Son« von Creedence Clearwater Revival oder »Fuck tha Police« von N.W.A. In ihrem Podcast-Beitrag »Pink Resistance« im BR2-Zündfunk haben Katja Engelhardt und Vanessa Schneider jedoch kürzlich aufgezeigt, dass sich gegenwärtig gerade Mainstream-Popkünstlerinnen stärker politisch – und das heißt grob: gegen Trump – positionieren. Wenn auch bisweilen eher soft, in Allgemeinplätzen für Self-Love, Feminismus oder die Pride der LGBTQI+-Community wie »You Need To Calm Down« von Taylor Swift. Solche eher unspezifischen politischen Stellungnahmen von Mainstream-Popstars ergänzen heute traditionelle Protestsongs von sich explizit als herrschaftskritisch verstehenden Gruppen wie Run the Jewels mit »Ju$t« oder A Tribe Called Quest mit ihrem Anti-Trump-Track »We the People…«.
Der Pop-Protest ist sicher nicht allein in Trump begründet. Eine große Rolle spielen, so die Philosophin Robin James von der University of North Carolina im Zündfunk-Podcast, die im letzten Jahrzehnt aneinandergereihten, sich verstärkenden Protestwellen gegen weiterhin herrschende Ungleichheit in den USA: die Black-Lives-Matter-Bewegung, die Pride-Bewegung oder der Women’s March. Trump dient diesen Bewegungen als willkommenes Feindbild, ein Gegenüber, dessen Egomanie eine dermaßen große Zielscheibe abgibt, dass Kritik und Protest immer treffen, gleichzeitig aber abzuperlen scheinen. Protest als Profilierung gegen Trump bedeutet, dessen Spiel mitzuspielen und selbst Politik als Mittel von Popularität zu begreifen. So konstatieren Engelhardt und Schneider desillusioniert: »Unsere Stars sind nicht nur so politisch, weil es Trump gibt, sie sind es, weil durch ihre große Reichweite und Strahlkraft das Prinzip Donald Trump auch auf sie selbst zutrifft.«
»The people that still like him, they’re lost.«
Pop wird in der Politik zum Vehikel der Aufmerksamkeitserzeugung – und anders herum. Der Comedian Patton Oswalt bringt diesen Umstand in seinem Netflix-Programm »I Love Everything« auf den Punkt: »I don’t have any Trump material. What is the point at this point? The people that hate Trump, hate him. The people that still like him, they’re lost.« Die Trump-Präsidentschaft vergleicht Oswalt mit dem Effekt eines LKW-Unfalls, in dessen Folge durchfallverschmierte Affen auf Koks umherrennen – sich dazu zu verhalten sei wohlfeil, jeder Kommentar und jeder Überzeugungsversuch müsse angesichts des Schauwerts von Trump fehlschlagen. Denn nichts scheint Trump zu blöde zu sein: Nicht, den eigenen mit Unbelesenheit und Dreistigkeit gepaarten Größenwahnsinn öffentlich auszustellen. Nicht, einen Song wie den oben erwähnten »Fortunate Son« zum Zweck der Anti-Establishment-Inszenierung für die eigene Campaign-Rallye zu wählen. Übrigens entgegen der Unterlassungsaufforderung des Creedence-Sängers John Fogerty – und entgegen der Tatsache, dass der im Song kritisierte Glückspilz ziemlich genau Donald Trump, »born silver spoon in hand«, sein könnte.
Diese kognitiven Dissonanzen stören Trump nicht, sie machen ihn im Gegenteil erst erfolgreich. Und so scheint es ihm nicht nur nicht zu blöde zu sein, am Ende seiner Rallyes in einen ungelenken Tanz zu verfallen, immer knapp am Discobeat von »YMCA« der Village People vorbei, einer Schwulenhymne. Spencer Kornhaber hat in The Atlantic darauf hingewiesen, dass Trumps kippelige Selbstinszenierung vermittels YMCA konträr zu seiner Politik einer stärkeren Diskriminierung nicht nur sexueller Minderheiten steht. Der Tanz ist am besten als Kapern einer Ästhetik zu verstehen, die Susan Sontag mit dem Begriff »Camp« belegt hat, einer Ästhetik, die Trumps ernster Wiederwahlkampagne, so Kornhaber, zugleich die wahnhaften Heiterkeit einer Drag Queen verleihe: Es erscheint offensichtlich, dass Trump lächerlich ist, jedoch weniger offensichtlich, ob er das auch weiß. Es ist diese Unklarheit, die einen guten Teil der Faszination ausmacht, mit der wir auf ihn blicken. Und am Ende hat er doch nur erreicht, was er will: Die Leute reden über ihn, die Nummer eins. In diesem Sinne wurde auch die zynisch gemeinte TikTok-Challenge, den Trumptanz einzuüben, schnell affirmiert und führte zu einem Retweet mit positivem Kommentar von Tochter Ivanka.
Also lieber nicht mehr mit Trump aufhalten und schnell das Thema wechseln. Wobei, Joe Biden gibt in Punkto Pop nun wirklich nicht viel her. Dann schon eher Bernie Sanders, für den etwa Vampire Weekend-Sänger Ezra Koenig geworben hat. Sanders aber wird sicher nicht mehr Präsident. Bessere Chancen hat da schon Alexandra Ocasio-Cortez, die als jüngste Kongressabgeordnete aller Zeiten bereits das absolut pop-taugliche Namenskürzel AOC führt. AOC ist ähnlich Social-Media-affin wie Donald Trump, berichtet auf YouTube für die Zeitschrift Vanity Fair von ihrem Tag, streamt auf Twitch, wie sie das Computerspiel »Among us« spielt – und sie tanzt. Nachdem sie 2019 für ein Video aus Collegezeiten kritisierte wurde, in dem sie auf einem Dach tanzt, konterte sie mit einem Tanzvideo zu Edwin Starris Protestsong »War« auf dem Flur des Kongressgebäudes. Congresswomen dance too – unabhängig vom Wahlausgang sollte uns das Hoffnung geben und die eigenen Beine in Schwung versetzen. Frei nach Justice: »Do the D.A.N.C.E., stick to the B.E.A.T«.
https://twitter.com/AOC/status/1081234130841600000?s=20
Erschienen am 03. November 2020
Playlist
Affen auf Koks
Die komplette Playlist Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Nada Surf
Popular Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Savage/Coldplay
Viva la Swing Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Prince
Ronnie Talk to Russia Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
The Chicks
Travellin’ Soldier Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Lily Allen
Fuck You Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
BTS
Mic Drop (Steve Aoki Remix) Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Kendrick Lamar
Alright Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Billie Holiday
Strange Fruit Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Creedence Clearwater Revival
Fortunate Son Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
N.W.A
Fuck Tha Police Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Taylor Swift
You Need to Calm Down Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Run the Jewels (ft. Pharrell Williams, Zach de la Rocha)
Ju$t Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
A Tribe Calle Quest
We the People… Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Village People
YMCA Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Edwin Starr
War Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Justice
D.A.N.C.E.Auf Spotify anhören Auf YouTube anhören
Inhalt
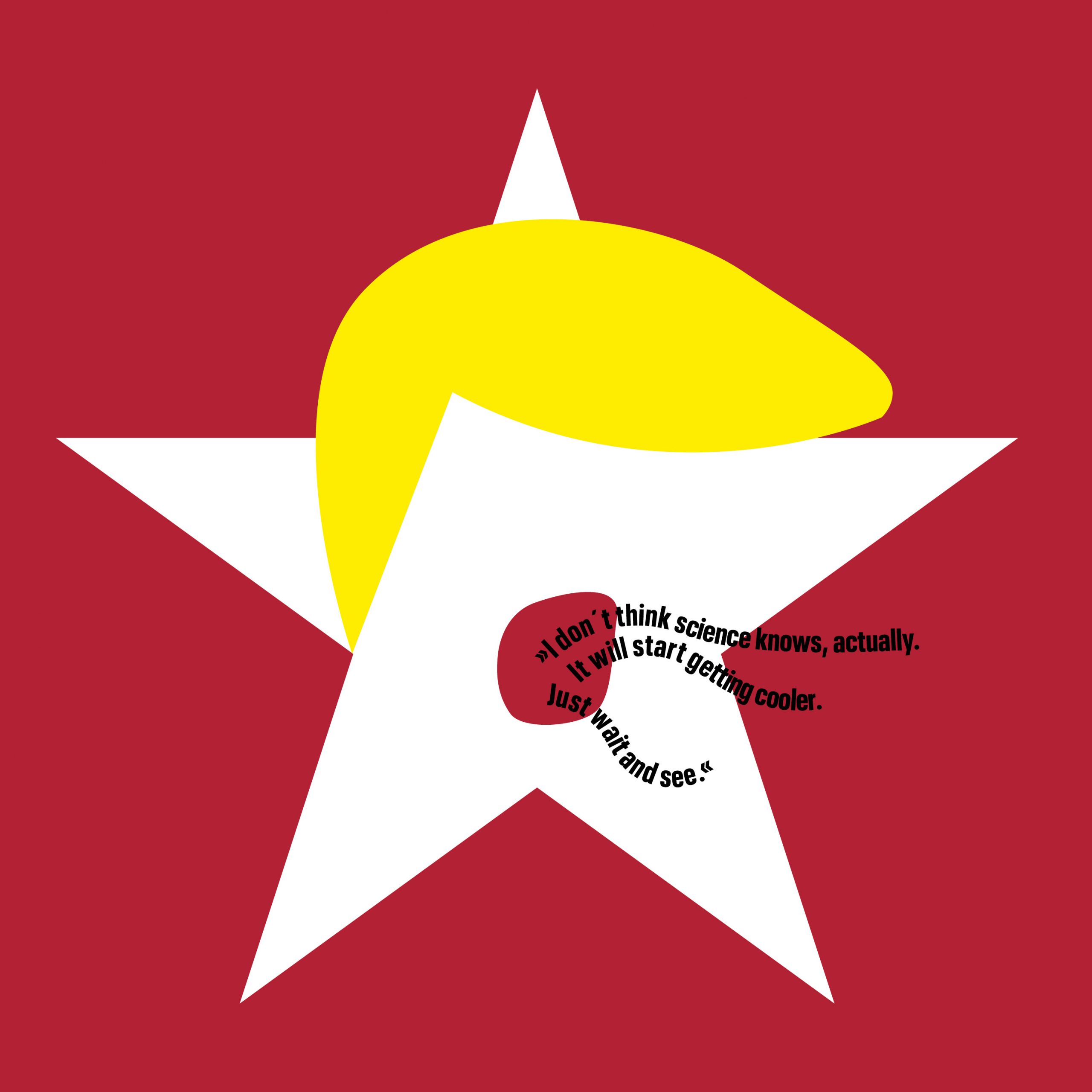
I don`t think science knows
Was wir von Donald Trump über das komplexe Verhältnis von Wissenschaft und Politik lernen konnten

Im Land der unbegrenzten Wahrheiten
Vor vier Jahren wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt – was bedeutet das für Menschen, die zum Studieren und Forschen in die USA gingen? Und was erhoffen sie sich von dieser Wahl? Fünf Erzählungen.
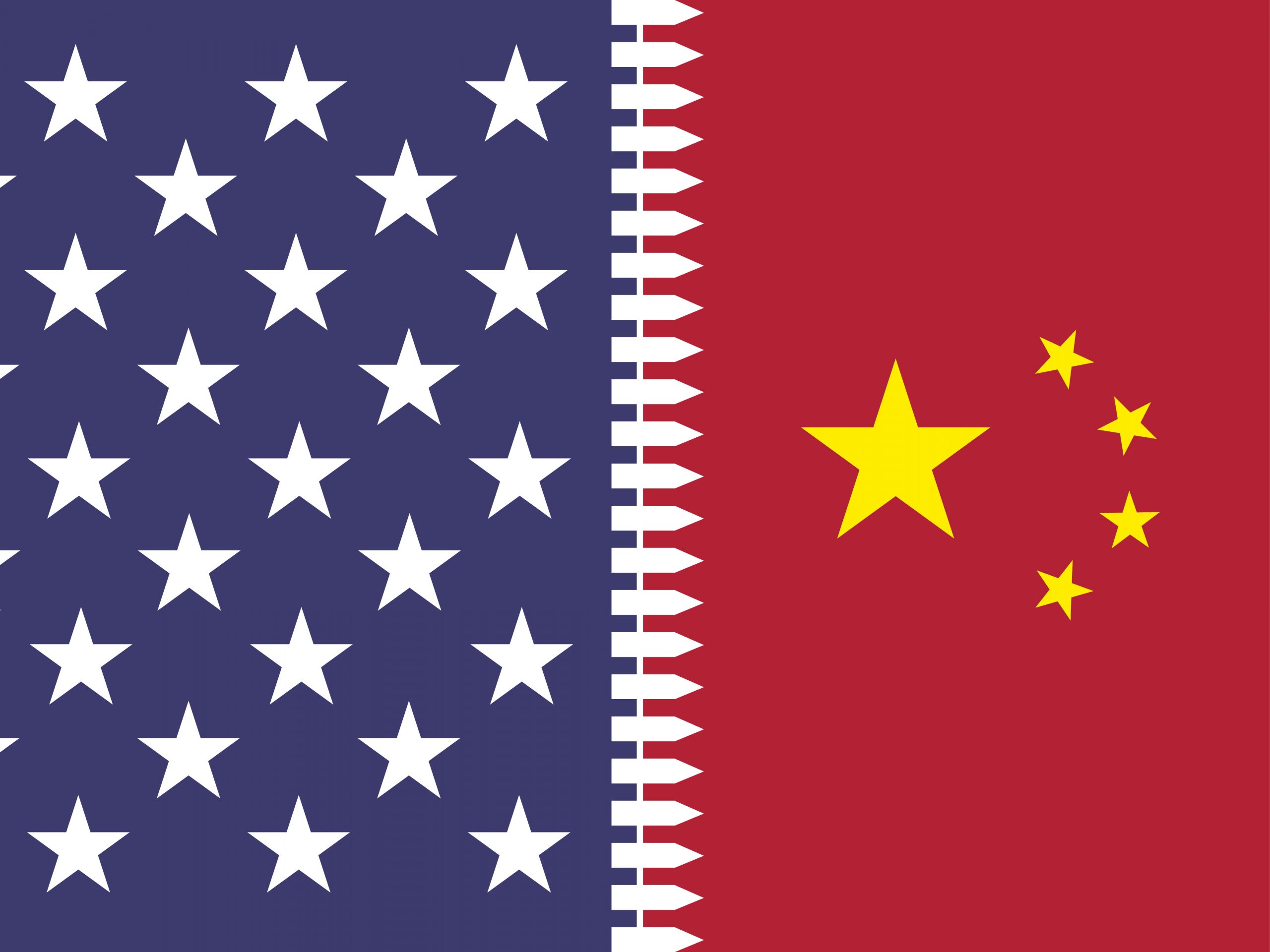
Schlaue Amerikaner gehen nicht in die Wissenschaft
Thomas Südhof ging 1983 zum ersten Mal in die USA, um als Postdoktorand zu arbeiten. Heute ist der Nobelpreisträger zunehmend irritiert von der amerikanischen Gesellschaft. Ein Interview.

Im Leuchtturm gehen die Lichter aus
Wie blicken deutsche Wissenschaftler*innen auf ihren Aufenthalt in den USA zurück? Wie blicken sie den Wahlen entgegen? Und was werden sie vermissen an den USA? Drei Forschende erzählen.
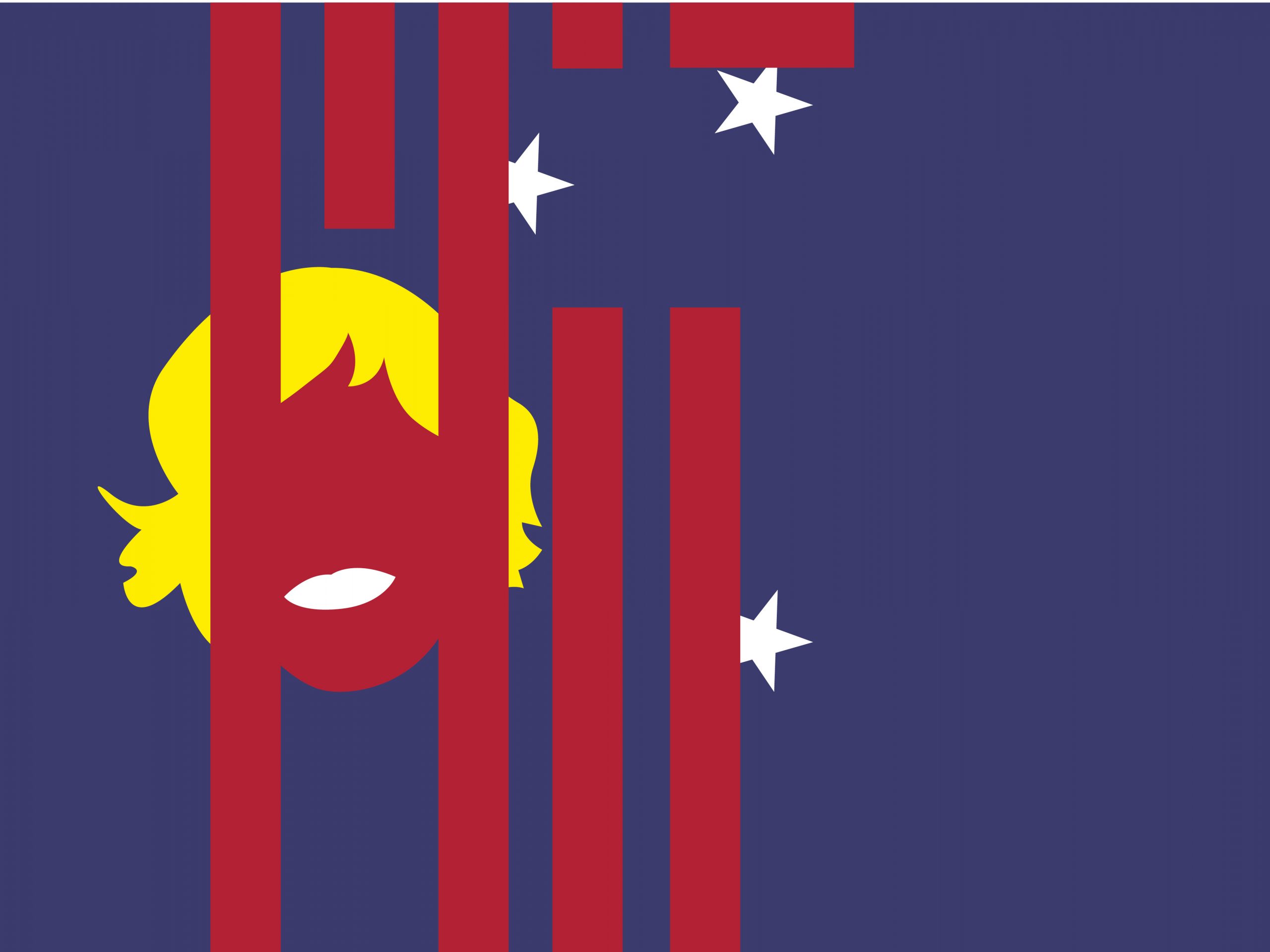
Meditieren gegen Trump
Die Journalistin Eva Wolfangel verbrachte ein Jahr als Stipendiatin in den USA. Um die Realität unter Trump auszuhalten, braucht es kreative Mittel, beobachtete sie. Ein surrealer Reisebericht.
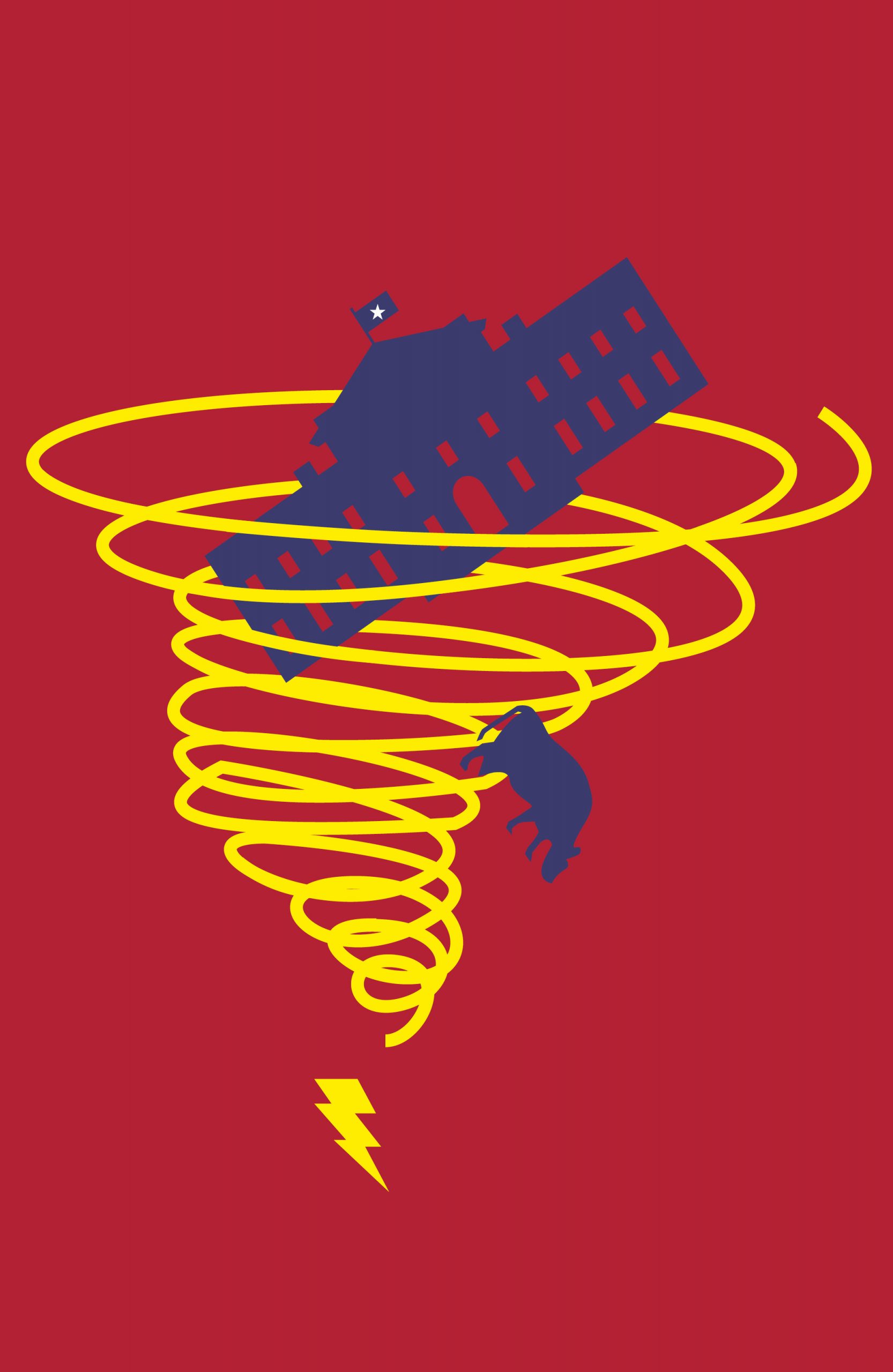
Der Sturmbeobachter
Mit zwei Jahren Verspätung wird Kelvin K. Droegemeier vereidigt als erster wissenschaftlicher Berater von Donald Trump. Wer ist dieser Mann? Versuch einer Annäherung.
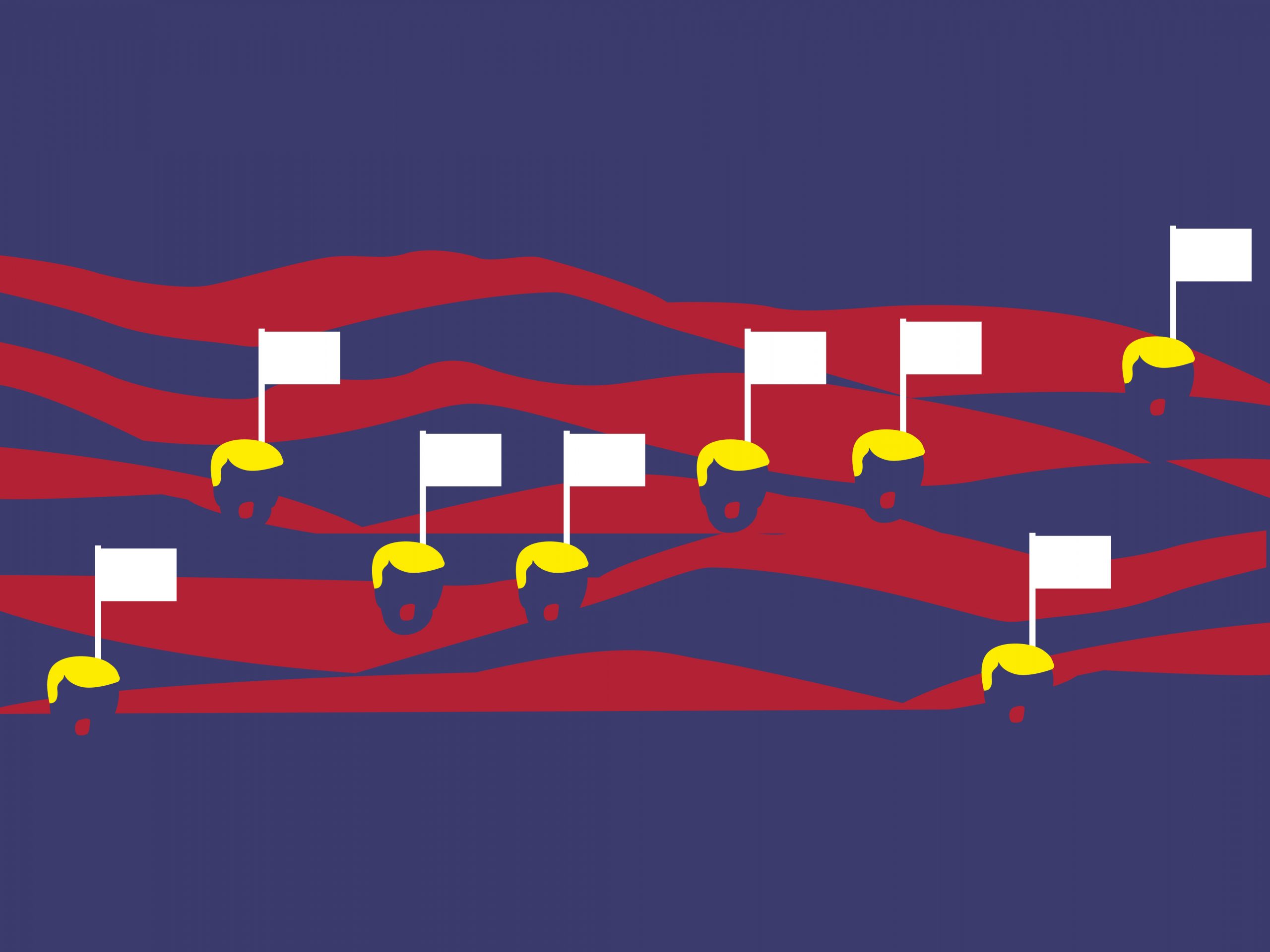
Affen auf Koks
Trump tanzt, während die Popmusik auf die Barrikaden geht: Wenn sich Politik zum Pop-Zirkus wandelt, werden Popstars plötzlich politisch.