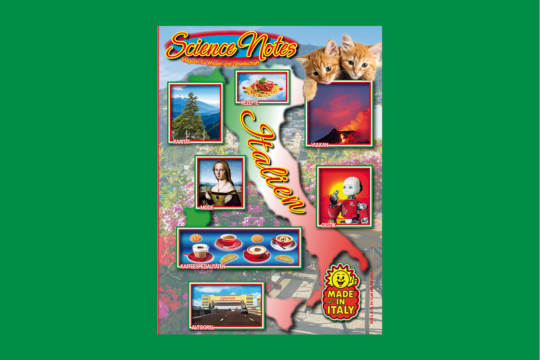Das Vagina-Problem
Viele Eltern scheuen sich, die Vulva ihres Kindes als solche zu benennen. Die Forschung zeigt aber, dass genau das wichtig ist – für das kindliche Körperbild und das Wahren der eigenen Grenzen.
Ein junges Mädchen, elf oder zwölf Jahre alt, rennt aufgeregt über das Gelände einer Jugendhilfeeinrichtung. »Mein Schmetterling blutet!«, ruft sie. Niemand versteht, was sie meint. Erst nach und nach wird klar: Das Mädchen hat ihre erste Menstruation. Das kann sie niemandem erklären, weil sie nie gelernt hat, das Wort »Vulva« zu benutzen. Zu Hause, in ihrer Familie, sagt man stattdessen »Schmetterling«.
Es klingt wie eine Szene aus den Fünfzigerjahren. Tatsächlich stammt sie aus der heutigen Zeit. Erlebt hat sie der Sexualpädagoge Carsten Müller, der seit vielen Jahren in Deutschland zu kindlicher Sexualbildung arbeitet. Eltern, beobachtet er, tun sich immer noch schwer damit, die Genitalien von Kindern mit klaren, allgemein verständlichen Begriffen zu benennen. Ohne Verniedlichung, ohne Spitznamen. Das gilt besonders für die Vulva. »Schmetterling höre ich ständig«, sagt er. Dieses Phänomen ist weit verbreitet.
Bereits 2016 erforschte die irische Sozialwissenschaftlerin Catherine Conlon am Trinity College in Dublin, wie Eltern mit ihren Kindern über Körper, Beziehungen, Sexualität und Reproduktion sprechen. Sie führte damals 20 Gesprächsrunden mit 93 Eltern und Erziehungsberechtigten, deren Kinder zwischen vier und neun Jahre alt waren. In diesen sogenannten Fokusgruppen tauschten sich die Teilnehmenden über ihre Erfahrungen mit kindlicher Sexualaufklärung aus. Die Eltern waren gebeten worden, offen darüber zu sprechen, wie sie mit ihren Kindern über Körper, Sexualität und Aufklärung reden. Bereits in den ersten Gesprächsrunden zeigte sich ein wiederkehrendes Muster: Beim Thema Vulva wurde es auffällig still. »Viele Eltern fanden es deutlich schwieriger, über die weiblichen Genitalien zu sprechen, als über den Penis«, sagt Conlon.
Die Forscherin ließ das nicht los. Also analysierte sie mit der Juristin Áine Mannon Jahre später die Gespräche noch einmal. Die Forscherinnen legten den Fokus dabei spezifisch auf eine neue Frage: Wie sprechen Eltern über Genitalien, insbesondere über weibliche? Daraus entstand 2024 eine Studie mit dem Titel The Vagina Problem.
Die Analyse zeigt: Die Eltern vermieden es, die Genitalien der Kinder mit anatomisch korrekten Begriffen zu benennen. Stattdessen verwendeten sie verniedlichende Wörter und Umschreibungen. Das taten sie bei Jungs und bei Mädchen. Dabei gab es aber einen wichtigen Unterschied: Für den Penis verwendeten sie verbreitete Begriffe, die alle verstanden. »Willy« etwa war eine häufige Bezeichnung, zu deutsch würde man »Pimmel« sagen. Für das weibliche Geschlechtsorgan gab es dagegen keinen einheitlichen Ausdruck. Jede Familie schien dafür einen eigenen Begriff zu schaffen, oftmals stark verfremdend – wie eben »Schmetterling«.

Das bringt nicht nur Kommunikationsprobleme mit sich, wenn ein Kind außerhalb der eigenen Familie über seine Vagina sprechen möchte. Es zeigt auch ein kulturelles Ungleichgewicht: Der Penis ist sichtbar und sprachlich verankert. Die Vagina dagegen? Wird umschrieben und ausgeklammert. Die Eltern aus der irischen Studie führten diese Sprachlosigkeit fort. Die Forscherinnen schreiben: »Das kann dazu führen, dass Vorstellungen von der Vagina, der Geburt, der Menstruation oder Masturbation als etwas Beschämendes oder Tabuisiertes fortgeschrieben werden.«
Im Alltag führt das zu absurden Szenen. Eine Mutter erzählte in der Studie, dass ihre Tochter das Wort »Vagina« nicht kannte, stattdessen sagte sie »Po« oder »Mary«. Als das Kind in der Kita eine Ordensschwester namens Mary traf, rief sie deshalb einmal: »Oh, du heißt wie mein Po!« Die Mutter, so heißt es im Protokoll, lief vor Scham hochrot an.
Vielen Eltern haben oft selbst gesellschaftliche Tabus verinnerlicht oder schämen sich, wenn sie die anatonmisch korrekten Begriffe für weibliche Geschlechtsorgane nutzen. Dabei wünschen sie sich eigentlich eine offene Kommunikation mit ihren Kindern und eine bessere Aufklärung, als sie selbst erlebt haben. »Aber gleichzeitig setzen sie Grenzen – besonders beim Thema weiblicher Körper«, sagt Conlon.
Um das zu ändern, fehlt den Eltern jedoch meist das Wissen darüber, welche Sprache für Kinder angemessen ist. Die Analysen der Gespräche in Conlons und Mannions Studie zeigen, dass viele Eltern Begriffe wie »Penis« oder »Vulva« nicht für kindgerecht halten. Wissen über Sexualität und den Körper empfanden viele Teilnehmende als unvereinbar mit der Idee von Kindheit. Das galt besonders für den weiblichen Körper. »Der Schutz des Kindes vor der Vagina und ihren Funktionen wurde von den Eltern als ein Ansatz angesehen, um den Übergang des Kindes vom Kindesalter zum Erwachsenenalter zu verlangsamen und den Übergang vom ›Nichtwissen zum Wissen‹ zu verzögern«, so Conlon.
Natürlich ist es auf diese Weise auch schwer, mit Kindern über Geburten zu reden. Die Eltern in der Studie The Vagina Problem erzählten ihren Kindern etwa, dass Babys »aus dem Bauchnabel« kämen oder über »magische Reißverschlüsse« aus dem Körper der Mutter geholt würden. Kim, eine Mutter, erklärte, wie froh sie war, ihre Kinder nicht belügen zu müssen, weil sie nur Kaiserschnittgeburten hatte. »Als die Kinder alt genug waren, um zu verstehen, dass da ein Baby wächst, und fragten, wie es herauskommt, konnte ich sagen: Der Arzt schneidet mich auf und holt das Baby raus – anstatt das Ganze mit der natürlichen Geburt erklären zu müssen.«
»Auch das deutet darauf hin, dass der weibliche Körper im Familiendiskurs mit jüngeren Kindern als potenziell brisanter, beunruhigender und störender dargestellt wird«, sagt Conlon. Das spiegelt tief verwurzelte kulturelle Narrative wider, wie die Vorstellung, dass weibliche Sexualität schwer zu kontrollieren sei oder eine besondere Form von »Schutz« erfordere. Um solche Narrative aufzubrechen, braucht es Aufklärung für die Eltern – etwa darüber, welche Sprache über Sexualität und Körper für Kinder am besten ist.
Diese Unsicherheit beim Benennen von Geschlechtsteilen bei Kindern beobachtet Carsten Müller auch in Deutschland. »Popo vorne« sei für ihn einer der schlimmsten Begriffe für die Vulva, sagt er. Er suggeriert, die Vulva sei lediglich ein Teil des Gesäßes. »Aber wenn die Vulva in Kinderbüchern nur als Strich dargestellt wird, wie der Po auch, dann liegt das nicht an den Eltern allein.«

Dabei prägt die sprachliche Benennung, ob ein Kind ein klares, positives Verhältnis zu seinem Körper entwickelt, betont Müller. Auf dem Wickeltisch fängt es an: »Jetzt mach ich deinen Bauch sauber. Jetzt deinen Penis.« Solche Sätze seien bei Eltern Alltag. »Jetzt mach ich deine Vulvalippen sauber – das sagt kaum jemand«, so Müller. »Wie soll ein Kind ein gutes Körpergefühl entwickeln, wenn es für wichtige Körperteile keine Wörter kennt?«
Auch Fachgesellschaften raten, Kindern unbedingt die anatomisch korrekten Begriffe beizubringen. In einem Elternratgeber des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit heißt es: »Wenn Sie Bezeichnungen für den Körper verwenden, schließen Sie den ganzen Körper mit ein und benennen Sie auch die Geschlechtsteile mit Penis, Hoden, Vulva und Klitoris. Im Sinne der Prävention wirken Sie so einer – möglicherweise ungewollten – Tabuisierung entgegen.«
Studien zeigen, dass Kinder, die ihre Genitalien anatomisch korrekt benennen können, nicht nur über ein klareres Körperbild verfügen. Sie können auch Grenzverletzungen besser benennen und werden in Missbrauchsinterviews als glaubwürdiger eingeschätzt. Das zeigt, wie wichtig Sprache ist: Wer Worte hat, kann sich ausdrücken – und schützen.
Wenn Eltern Kindern Körperwissen vorenthalten, wollen sie zwar genau das: ihre Kinder schützen. Doch schaffen sie damit vor allem Unwissen, statt zu schützen. Dabei brauchen Kinder gar keine Märchen über Genitalien, Geburt und Sexualität: »Für Kinder ist Vulva einfach Vulva. Penis ist Penis. Das sind Wörter wie ›Auto‹ oder ›Tisch‹«, sagt Müller. Erst Erwachsene machen daraus ein Problem.
Erschienen am 9. Oktober 2025
Quellen
- Brilleslijper-Kater, S. N., & Baartman, H. E. M. (2000). What do young children know about sex? Journal of Sex Education and Therapy, 25(1), 48–58. https://doi.org/10.1002/1099-0852(200005/06)9:3<166::AID-CAR588>3.0.CO;2-3
- Conlon, Catherine (2018). Research About Supporting Parents Communicating with Children Aged 4–9 Years about Relationships, Sexuality and Growing Up, https://www.lenus.ie/bitstream/handle/10147/623525/Supporting%20Parents%20Summary.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mannion, Á. B., & Conlon, C. (2024). The vagina problem: a step too far in parent–child sex communication with young children. Sex Education, 25(3), 376–389. https://doi.org/10.1080/14681811.2024.2342880.
- Ratgeber des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) (ehemals Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung): https://shop.bioeg.de/trau-dich-ein-ratgeber-fuer-eltern-16100102/
- Wurtele, Sandy K., & Kenny, Maureen C. (2010). Partnering with Parents to Prevent Childhood Sexual Abuse. Child Abuse Review, 19(2), 130–152. https://doi.org/10.1002/car.1112
Newsletter
Jeden Monat ein Thema. Unseren Newsletter kannst du hier kostenfrei abonnieren: