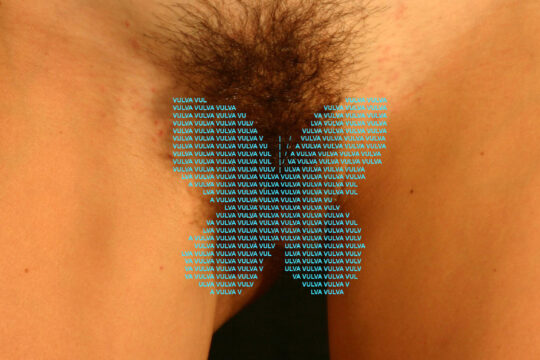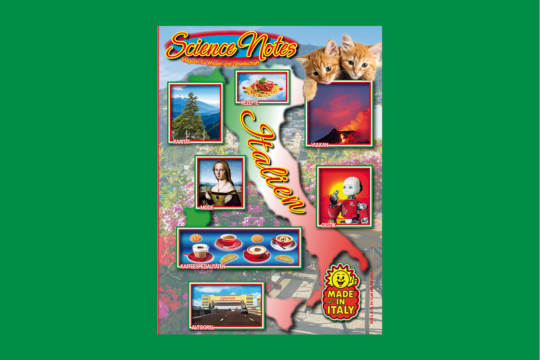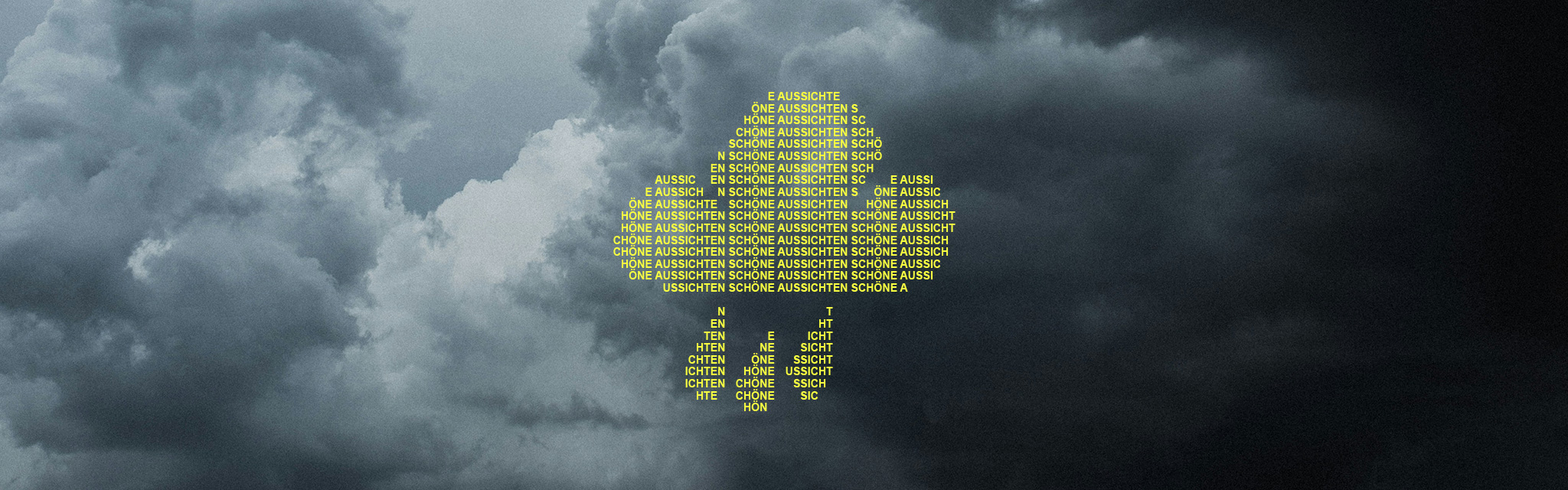
»Erzählungen sind oft unsichtbar, aber sehr mächtig«
Es kommt nicht nur darauf an, was wir sagen, sondern auch wie wir es sagen – denn das beeinflusst unser Denken und Handeln. Arran Stibbe untersucht, wie Sprache unsere Haltung zur Natur formt. Ein Gespräch über sprachliche Hebel für Veränderung und neue Narrative, die wir finden müssen – schließlich geht es um das Überleben unserer Spezies.
Herr Stibbe, inwiefern trägt Sprache zur Zerstörung unserer Umwelt bei?
Ein einfaches Beispiel ist der Wetterbericht. In den Vorhersagen wird sonniges Wetter oft als fantastisch dargestellt, während Nebel, leichter Regen oder Wolken sehr negativ beschrieben werden. TV-Meteorolog:innen sprechen manchmal vom »Hereinbrechen von Schauern« oder von einem »trüben Tagesbeginn«. Reiseunternehmen greifen diese Geschichte auf und animieren uns, um die Welt zu fliegen, um vermeintlich besseres Wetter zu finden. Aus der Frage, wie Sprache unsere Haltung gegenüber der Natur formt und welche Konsequenzen das hat, ist ein eigener Forschungszweig entstanden: die Ökolinguistik.
Wo setzt die Ökolinguistik an?
Es geht um eine kritische Untersuchung der Geschichten, die in unserer Sprache verborgen sind. Wir analysieren, ob sie das Leben auf der Erde eher unterstützen oder zu dessen Gefährdung beitragen.
Sie sprechen von »Geschichten, nach denen wir leben«…
Damit meine ich all jene Narrative, die unser Denken, Fühlen und Handeln leiten. Sie begegnen uns in Schulbüchern, Werbung, politischen Reden. Zum Beispiel die Vorstellung, dass ständiges Wirtschaftswachstum normal und notwendig sei. Oder die Idee, dass der Mensch über der Natur steht. Diese Erzählungen sind oft unsichtbar, aber sehr mächtig. Wenn wir sie nicht hinterfragen, reproduzieren wir sie unbewusst. Mich interessiert, wie wir diese Muster durchbrechen können. Dafür müssen wir sie zunächst sichtbar machen.
Wie sieht das in der Praxis aus?
In einer Studie haben wir zum Beispiel über 120 Wirtschaftslehrbücher analysiert. Wir haben uns angeschaut, wie über Menschen, Märkte und Natur gesprochen wird. Begriffe wie Empathie oder Fürsorge kamen so gut wie nie vor. Dafür dominieren Begriffe wie Effizienz, Wachstum, Wettbewerb. Die Natur ist bloß Rohstoff, den es zu verwerten gilt, und Menschen werden auf ihre Funktionen als Verbraucher:innen oder Produzent:innen reduziert.
Was wissen Sie über den Effekt einer solchen Sprache?
Studien zeigen, dass schon das Lesen solcher Texte ausreicht, um Menschen weniger mitfühlend zu machen. Sie sind anschließend weniger bereit, sich freiwillig zu engagieren oder umweltfreundlich zu handeln. Schon allein das Nachdenken über ökonomische Prinzipien mindert unsere Empathie. Diese Lehrbuch-Narrative fließen in politische Entscheidungen ein, beeinflussen Wirtschafts- und Unternehmenspolitik – und damit unsere Gesellschaft. So wird dieses ökonomische Weltbild aktiv gefördert. Wenn neoliberale Politiker:innen etwa soziale Ungleichheit als wichtige Motivation für Menschen beschreiben, sich wirtschaftlich anzustrengen, wird aus einer Theorie eine soziale Realität. Darin scheint es fast eine Notwendigkeit, dass Menschen in Existenzangst leben. Die Sprache der Wirtschaft erzieht uns zu einer bestimmten Sicht und einem bestimmten Verhalten – und das ist mit den ökologischen und sozialen Herausforderungen, vor denen wir stehen, schlicht unvereinbar.
Wie konnten sich die großen Geschichten, nach denen wir leben, denn so verfangen?
Eine erste Veränderung kam mit dem Geld. Bevor es das gab, mussten Menschen Dinge miteinander teilen. Hatte einer besonders viel Fisch, ergab es Sinn, davon etwas abzugeben, bevor er schlecht wurde. Aber Geld wird nicht schlecht. Wir wollen davon mehr und mehr haben. Ein weiterer Umbruch war die industrielle Revolution. Bevor wir fossile Brennstoffe nutzten, war das menschliche Überleben abhängiger von der Umwelt. Die respektvolle Haltung indigener Kulturen gegenüber der Natur rührt sicherlich auch daher. Man wusste: Wenn wir unsere Umgebung zerstören, kann das unser Leben kosten. Die industrielle Revolution hat diese Verbindung gebrochen. Wir können alles Mögliche importieren, selbst wenn wir dabei unsere Umgebung zerstören. Das hat die Erzählung gefördert, dass der Mensch eigennützig ist, dass er über der Natur steht, dass wir immer mehr wollen.
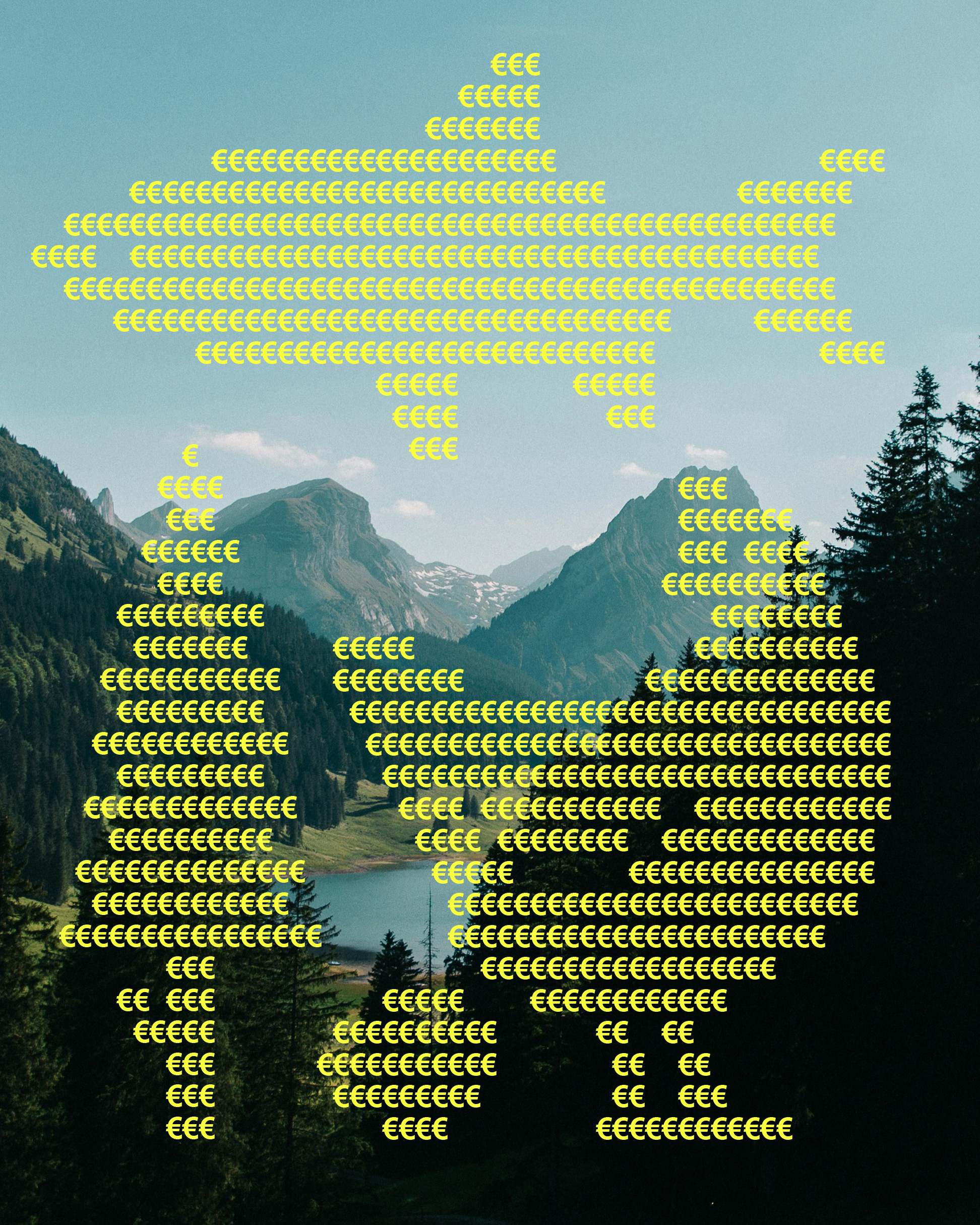
Gab es einen Moment, in dem Ihnen diese Narrative besonders bewusst wurden?
Ein Schlüsselmoment war für mich ein Zeitungsartikel über einen Fischereiskandal in Japan, in dem Tiere einfach als »Ressourcen« bezeichnet wurden. Diese Wortwahl hat mich schockiert. Komplexe Lebewesen wurden sprachlich auf den Status von Objekten reduziert – Dinge, über die man verfügen und deren Nutzen man maximieren kann. Da wurde mir klar, wie tief Sprache unser Denken über die natürliche Welt beeinflussen muss.
Welche Textformen eignen sich, um eine Verbindung zur Natur herzustellen?
Poesie kann eine Naturerfahrung auf verdichtete, minimalistische Weise ausdrücken. Ich habe etwa Haiku untersucht, eine traditionelle japanische Gedichtform, die aus drei Zeilen mit jeweils bestimmter Silbenanzahl besteht. Haiku arbeiten mit natürlichen Bildern, um Staunen, Respekt und Mitgefühl hervorzurufen. Sie laden uns ein, in Beziehung zu treten.
Gab es einen bestimmten Text, der Ihr persönliches Denken besonders geprägt hat?
Das war das Buch A Sand County Almanac des amerikanischen Försters und Ökologen Aldo Leopold. Es erschien 1949. Leopold argumentiert, dass wir Menschen innerhalb des Ökosystems stehen und Verantwortung für das Ganze tragen. Ethisches Handeln schließt für ihn auch die Erde, das Wasser und die Tiere ein. Das Werk hat mir gezeigt, was Narrative bewirken können: Nicht umsonst wurde Leopold zu einem Vorreiter des Naturschutzes und damit einer großen Bewegung, die heute nicht mehr wegzudenken ist. Das hat mich dazu motiviert, nach neuen Geschichten zu suchen, die wir dringend brauchen.
Haben Sie ein aktuelles Beispiel für so ein lebensförderndes Narrativ?
Ja, die Sprache von Rowen White, einer Saatgutbewahrerin der nordamerikanischen Mohawk-Tradition. Sie spricht davon, dass Samen Geschichten in sich tragen. In ihren Worten wird das Saatgut zu einem lebendigen, kulturell bedeutsamen Akteur. Sie stellt Pflanzen als Verwandte von uns dar. Die Konsequenz daraus ist, dass wir Pflanzen respektieren sollten. Dass sie uns geben, was wir zum Leben brauchen und wir ihnen deshalb auch etwas zurückgeben müssen. Diese Sichtweise steht im starken Kontrast zu technokratischen Narrativen über Gedanken oder Ertragsmaximierung.
Seit Jahrzehnten reden wir über die Klimakrise, doch es folgen zu wenige Taten. Was lähmt uns denn auf linguistischer Ebene?
Hinderlich ist die Beschreibung des Klimawandels als Umweltproblem. Ein »Problem« suggeriert, dass es eine ganz bestimmte Lösung geben muss. Das ist aber vereinfachend, vielleicht irreführend. Wenn wir dann bei der angestrebten Klimaneutralität von der »Nettonull bis 2050« sprechen, wird daraus eine Variable, eine Zahl. Wir denken dann, es sei noch eine Menge Zeit und das alles betreffe andere Menschen in einer fernen Zukunft. So wird sich aber nichts ändern. Im Gegenteil: Laut Prognosen soll sich die Chemieproduktion bis 2050 verdreifachen, die Plastikproduktion mindestens verdoppeln und der Reiseverkehr um fast die Hälfte zunehmen. Die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre steigt weiter an. Für mich ist der Klimawandel daher folgendes: eine komplexe und umfassende Zwangslage, die uns alle schon heute angeht und uns entschiedenes Handeln abverlangt. Etwas, das nicht verschwinden wird, mit dem wir leben und unausweichlich umgehen müssen.
Motiviert es eher zum Handeln, wenn wir statt von »Klimawandel« konsequent von »Klimakrise« sprechen – etwa im Journalismus?
Worte wirken auf unterschiedliche Gruppen ganz verschieden. Deshalb beschäftige ich mich nicht mit Publikumsanalysen. Ich will weg von der Idee, dass wir einfach nur Wort X durch Wort Y ersetzen müssen.
Was interessiert sie stattdessen?
Ich schaue mir eher den allgemeinen Diskurs über den Klimawandel an und analysiere, welche Aspekte bei den unterschiedlichen Erzählarten mitschwingen: Caroline Lucas, eine Abgeordnete der britischen Grünen, beschreibt den Wandel als Sicherheitsrisiko, was eine große Dringlichkeit vermittelt. Es erscheint dann logisch, dass wir viele Ressourcen und Energie investieren müssen. Die amerikanische Schriftstellerin Rebecca Solnit sieht eine Form von Gewalt gegen marginalisierte Menschen, ausgeübt von den Industrienationen. Das verleiht dem Thema eine ethische Dimension.
Welche Beschreibung halten Sie für hilfreich?
Ich mag das Framing der kanadischen Journalistin Naomi Klein: Sie sieht den Klimawandel als Chance, die Ausrichtung unserer Gesellschaft und unser Verhältnis zur Natur grundlegend zu überdenken. Er dient als ein Beweis dafür, dass unsere Konsumweisen nicht nachhaltig sind, dass unsere Zivilisation so nicht zukunftsfähig ist. Klimawandel wird zur Gelegenheit, alles neu zu denken. Wir müssen eben nicht nur einzelne Worte austauschen. Stattdessen brauchen wir einen völlig neuen Diskurs. Manchmal denke ich, die beste Art über Klimawandel zu sprechen ist, gar nicht vom Klimawandel zu sprechen.
Wie bitte?
Der Klimawandel ist kein isoliertes Problem, seine Wurzeln reichen tief in unser Denken hinein. Wir müssten eigentlich von einem »Kapitalismusproblem« sprechen und von der Wurzel allen Übels: dem Diktat des Wirtschaftswachstums. Gleichzeitig ist das für viele Menschen sehr abstrakt. Daher ist es vielleicht besser, die Dinge in den Fokus zu rücken, die für die Menschen greifbar sind – verschmutztes Wasser, schädliche Lebensmittel, Feinstaub in der Luft, das Schwinden der Wälder.
Hat sich Ihr eigener Sprachgebrauch durch Ihre Arbeit verändert?
Ich versuche, Begriffe zu meiden, die Leben auf Funktionen reduzieren. Ganz praktisch nutze ich die Erkenntnisse aus meiner ökolinguistischen Analyse auch, um politische Veränderungen zu unterstützen. So habe ich zum Beispiel einen 100-seitigen Bericht geschrieben, in dem ich argumentierte, dass bestimmte Felder in der Nähe meiner Universität ein unverzichtbarer Rückzugsort für Menschen und Tiere sind. Die Strategie führte dazu, dass diese Felder inzwischen rechtlich geschützt sind – und darauf keine 5.000 Neubauten errichtet wurden.
Was wünschen Sie sich für die Sprache der Zukunft?
Ich wünsche mir vor allem, dass möglichst viele Menschen ein kritisches Bewusstsein für Sprache entwickeln. Fragen Sie sich: Welche Geschichte wird mir hier gerade erzählt? Eine Zivilisation hat grundlegende Narrative, die unter früheren Bedingungen funktioniert haben – aber diese Bedingungen können sich ändern. Und wir sehen heute den Klimawandel, den Verlust der Biodiversität, chemische Belastungen – die Welt verändert sich, nicht aber unsere Geschichten. Wenn wir die Geschichten, nach denen wir leben, nicht ändern, dann zerstören wir am Ende die Ökosysteme, von denen alles Leben abhängt.
Arran Stibbe unterrichtet Ökologische Linguistik an der University of Gloucestershire in England. Er gründete die International Ecolinguistics Association mit inzwischen über 1100 Mitgliedern.
Erschienen am 9. Oktober 2025
Quellen
- Bleumer, H.; Hannken-Illjes, K.; Till, D. (2019). Narration – Persuasion – Argumentation: Perspektiven eines offenen Diskurses. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. 49 (10). https://doi.org/10.1007/s41244-019-00121-7
- Fill, A. (2021). Ökolinguistik: Wie uns Sprache von der Umwelt zur Mitwelt führen kann. In Mattfeldt, A., Schwegler C., & Wanning, B. (Hrsg.). (2021). Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit: Perspektiven auf Sprache, Diskurse und Kultur. 307-324. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110740479-012.
- Hampe, M. (2018). EMPATHIE UND SPRACHE: Über Pflichten von Autoren und Lesern sich einzufühlen. Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft (ZÄK). 63 (1), 93.
- Leopold, A. (1949). A Sand County Almanac. Oxford University Press. https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/undergraduates/modules/fulllist/first/en124/leopoldsandcountyalmanacexcerpts.pdf
- Stibbe, A. (2007). Haiku and Beyond: Language, Ecology, and Reconnection with the Natural World. Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals, 20 (2), 101-112. doi:2752/175303707X207891
- Stibbe, A. (2020). Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live Routledge.https://www.routledge.com/Ecolinguistics-Language-Ecology-and-the-Stories-We-Live-By/Stibbe/p/book/9780367428419
Newsletter
Jeden Monat ein Thema. Unseren Newsletter kannst du hier kostenfrei abonnieren: