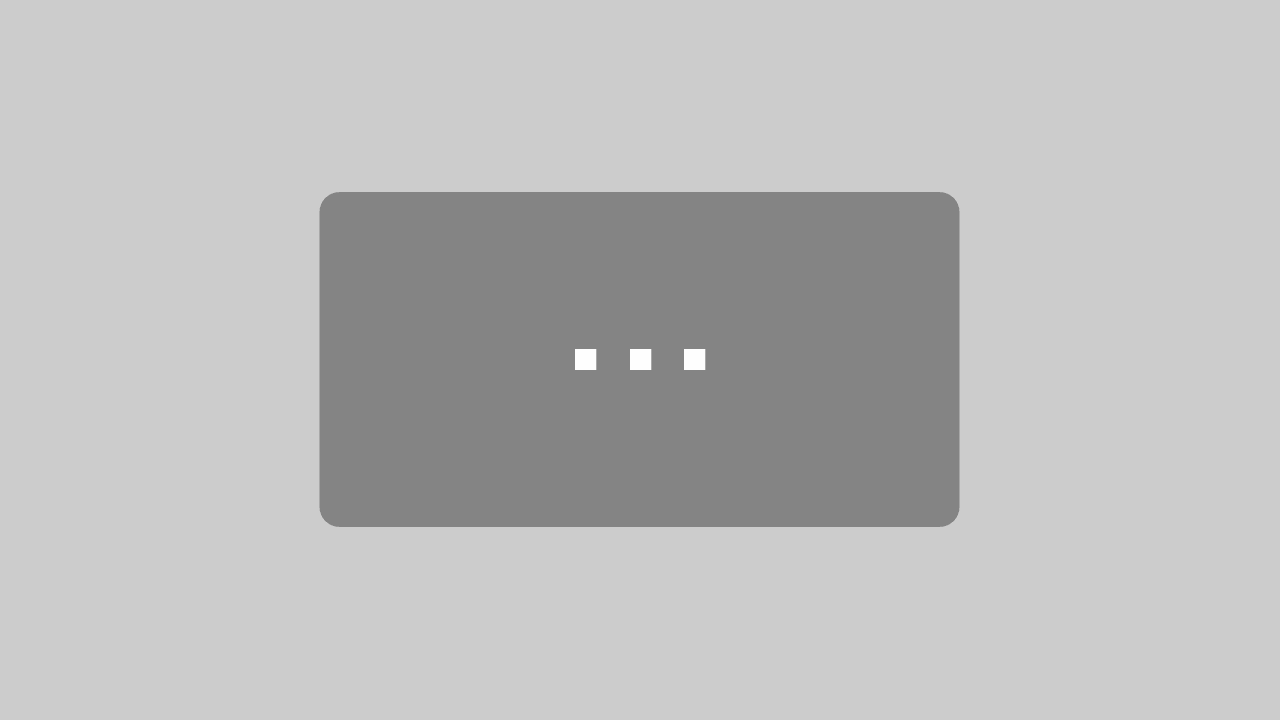Ergebnisse, Publikationen, Zitate sind die harte Währung in der Wissenschaft. Über Pannen, gescheiterte Experimente, misslungene Entwicklungen hingegen wird nicht gern gesprochen. Doch das Scheitern gehört zu jeder echten Forschung – die Wissenschaft muss lernen, es zu umarmen. Ein Plädoyer.
Als Burkard Baschek sah, dass das Seil am Heck des weißgrauen Forschungsbootes nicht mehr straff durch die Wellen des Pazifiks schnitt, war es bereits zu spät. Jeder Rettungsversuch wäre vergeblich. Das wusste der Küstenforscher sofort. Auch, was es bedeutete, dass das Spezialseil nun schlapp wie eine abgebissene Angelsehne im Wasser trieb: Monatelange Entwicklungsarbeit an einer innovativen Messmethode, wertvolle Daten sowie Sensoren für knapp 20.000 US-Dollar – alles tanzte gerade wie in Zeitlupe 1.000 Meter hinab auf den Grund des Ozeans.
Damals, im August 2008, war Baschek Assistenzprofessor für Ozeanografie an der UCLA in Kalifornien. Heute leitet der 50-Jährige – groß, schlank und mit nordisch-ruhiger Ausstrahlung – das Institut für Dynamik der Küstenmeere am Helmholtz-Zentrum Hereon im schleswig-holsteinischen Geesthacht. Offen erzählt er von der teuren Panne – und spricht damit über ein Thema, das viele Kolleg:innen meiden: Jene Momente in der Wissenschaft, in denen nicht alles nach Plan läuft; wenn Entwicklungen misslingen oder Experimente nicht die gewünschten Ergebnisse liefern; wenn Stichproben zu klein oder Proben verunreinigt sind, Anträge für Forschungsgelder oder Datenanalysen ins Leere laufen. Oder eben, wenn ein gesamtes Experiment im Pazifik versinkt.

Monatelange Entwicklungsarbeit, wertvolle Daten sowie Sensoren für knapp 20.000 US-Dollar – alles tanzte wie in Zeitlupe hinab auf den Grund des Ozeans.
Dabei sei nichts in der Wissenschaft natürlicher als das Scheitern, sagt Baschek mit Überzeugung: »Es ist allgegenwärtig – und zwar nicht nur bei Doktoranden, sondern auch bei den erfahrensten Professoren und Forschern.«
Woran aber liegt es dann, dass im wissenschaftlichen Diskurs so wenig übers Scheitern gesprochen wird? Welche Folgen hat das für den Forschungsbetrieb? Und wie lässt sich die Situation verbessern?
Etwa zwei Dutzend Wissenschaftler:innen, Forschungsinstitute und Vereinigungen für Wissenschaftskommunikation habe ich auf der Suche nach Antworten kontaktiert. Auch auf Twitter nach Feedback gefragt. Die Resonanz: erstaunlich mau. Oft kam keine Antwort. Oder es hieß, man könne nichts zum Scheitern beitragen. Auch mein Angebot, die Erfahrungen für den Text zu anonymisieren, änderte nichts.
Dabei reden Forscher:innen gern und viel über ihre Arbeit. Immer wieder verlieren sie sich bei Recherchegesprächen in kleinsten Details oder betonen die Bedeutung ihrer Forschung für das große Ganze. Zumindest, wenn es um Erfolgsgeschichten geht. Nur sind diese Meilensteine eben selten. Der Forschungsalltag besteht eher aus Geduld und Wiederholung – und oft aus Frust und Enttäuschung.
Was hinter Erfolgsmeldungen steckt
Doch nicht nur die Protagonist:innen sind schuld an diesem verzerrten Bild, das die Gesellschaft von der Wissenschaft hat. Es liegt auch an uns Nicht-Forschenden: Wir reflektieren zu wenig über die steten Erfolgsmeldungen und die oft mühevoll erarbeitete Lernkurve, die tatsächlich dahintersteckt. Wer den Fortschritt von der Wissenschaft einfordert – und das tun wir alle –, muss eingestehen: Neues zu entdecken, Wissensgrenzen zu verschieben und womöglich jahrzehntelang geltende, scheinbar unumstößliche Maximen zu widerlegen, das gelingt vor allem denen, die mutig genug sind, verschiedene Ansätze auszuprobieren. »Dass nicht jede Idee funktioniert, dass man bestimmte Aspekte nicht komplett durchdacht hat oder einfach nur Pech, das gehört dazu«, so Baschek.
Das vielleicht größte Problem liegt jedoch im Wissenschaftskosmos selbst. Denn in der Branche zählen vor allem: Veröffentlichungen und Zitationen, Forschungsaufenthalte, Preise, Stipendien. Zweifel, Rückschläge, Fehlschläge, sie stören in dieser Bilanz. Denn oft werden die nächsten Fördergelder und Projekte direkt an vorangegangene Erfolge geknüpft.
Ann-Sophie Barwich, Kognitionswissenschaftlerin und Philosophin an der Indiana University Bloomington in den USA, veröffentlichte 2019 im Fachmagazin Frontiers in Neuroscience einen Artikel über den Wert des Scheiterns in der Wissenschaft. Darin beklagt sie, dass das wichtigste Kriterium für den Erfolg wissenschaftlicher Arbeit das Veröffentlichen von Ergebnissen ist. All die Zwischenschritte, die kleinen und großen Rückschläge, spielen in einem solchen Paper keine Rolle. Dieses Vorgehen führe dazu, so Barwich, dass Laien ein verzerrtes Bild davon bekämen, wie Forschung funktioniert und wie dynamisch sie ist: Theorien ändern sich, Ergebnisse sind vorläufig, Annahmen werden korrigiert. Außerdem führe der Fokus auf die Produktion von verwertbaren Resultaten bei Wissenschaftler:innen zu dem (Selbst-)Verständnis, dass sie sich und ihre Arbeit primär durch Erfolge definieren. Und wenn die Ergebnisse eines womöglich jahrelangen Forschungsprozesses plötzlich innerhalb weniger Augenblicke verloren gehen, spricht darüber niemand gern.
Zehn Jahre Arbeit. Millionen Dollar investiert. Und noch immer keine Daten.
Viele Wissenschaftler:innen kritisieren diesen auf Leistung getrimmten Motor der akademischen Welt, der das notwendige Scheitern ausblendet. Auch Erika Hamden wünscht sich eine Abkehr vom Status quo. Die 38-jährige Astrophysikerin der University of Arizona arbeitet unter anderem für die NASA und deren Jet Propulsion Laboratory. Im April 2019 stand sie im kanadischen Vancouver auf der Bühne einer TED-Konferenz und erzählte, wie sie gescheitert ist. Nicht einmal, nicht zweimal. Zehn Jahre lang folgte bei der Entwicklung eines speziellen Ballonteleskops für die Erforschung von Wasserstoffpartikeln im Kosmos ein Rückschlag auf den nächsten: Hamden zerstörte versehentlich mehrere empfindliche, teure Sensoren. Verkratzte Spiegel mussten neu gefertigt werden. Dann versagte erst das Kühlsystem, später die Kalibrierung und während eines Testflugs landete ein Falkenbaby auf dem Teleskop. Als im August 2017, nach neun Jahren Entwicklungsarbeit, schließlich alles fertig war, wurden Hamden und ihr Team vom Wetter in die Knie gezwungen: Sechs Wochen Dauerregen – wohlgemerkt in der Wüste New Mexicos – machten einen Start unmöglich. Ein Jahr später, am 22. September 2018, hob das Teleskop endlich ab. Und zerschellte kurz nach dem Start auf dem Wüstenboden. Ein Loch in der hauchdünnen Ballonwand. Wo es herkam? Niemand weiß es. Zehn Jahre Arbeit. Millionen Dollar investiert. Und noch immer keine Daten.

Hamdens Vortrag wurde inzwischen fast 1,9 Millionen Mal angeklickt. Selten zuvor hat das Scheitern in der Forschung eine solche Bühne bekommen.
Wer entdecken will, muss Fehler machen
Ich erreiche die Physikerin per Videoanruf in den USA. Bereits nach wenigen Augenblicken wird deutlich: Hamden lebt für die Wissenschaft. Wenn die Frau mit den braunen Locken und dem einnehmenden Lächeln von ihrer Arbeit berichtet, fliegt ihre Begeisterung für die Rätsel des Universums durch die Luft wie Abermillionen energiegeladener Atome. Ironischerweise wurde der Erfolg ihres Vortrags erst durch das Scheitern möglich, sagt sie: »Ursprünglich wollte ich über all die großartigen Entdeckungen unseres Teleskops berichten. Doch da wir keine Ergebnisse vorweisen konnten, erklärte ich eben, woran das liegt.«
Auch hier verbirgt sich ein wichtiger Aspekt, den wir im Diskurs ums Scheitern oft vergessen: Die Wissenschaft unterscheidet zwischen explorativen Projekten, die nach neuen Erkenntnissen streben – und jenen, die Hypothesen überprüfen. Wer entdecken und über die Grenzen des bislang Bekannten hinausgehen will, wird Fehler machen. Muss Fehler machen. Ansonsten sind die Ideen nicht innovativ genug. Doch immer wieder landen in der öffentlichen Wahrnehmung explorative und überprüfende Ansätze in einem Topf – zu Unrecht. Diesen Fehler machen wir, nicht die Wissenschaft an sich.
Was heißt hier Scheitern?
Erliegen wir darüber hinaus noch einem weiteren, viel grundsätzlicheren Irrtum? Was, wenn es das Scheitern in der Wissenschaft gar nicht gibt? Wirklich scheitern würde nur, wer aufgibt, wenn etwas schiefläuft, sagt Hamden. Und verweist auf das Hubble-Weltraumteleskop: Tausende Menschen arbeiteten 44 Jahre lang, um diese Idee in den Orbit zu schicken. Auch hier gab es etliche Rückschläge. Solange man aber weitermache und etwas aus dem bisherigen Forschungsverlauf mitnehme, so Hamden, handele es sich um einen Lernprozess.
So ähnlich erklärt mir das auch Küstenforscher Burkard Baschek: »Wer viele Ideen hat, der wird auch viele verwerfen – doch ist es Scheitern, wenn ich das von Beginn an einkalkuliere?« Auch Angela D. Friederici, Direktorin der Abteilung Neuropsychologie am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, schreibt per Mail: Wissenschaft bedeute, ergebnisoffen zu arbeiten und unerwartete Daten nicht als Scheitern zu interpretieren. »Sie können auch neue Perspektiven eröffnen«, so Friederici.
Das stimmt – und ist trotzdem nicht die ganze Wahrheit. Denn es kommt auch darauf an, wie und warum manche Dinge schieflaufen. Und ob bestimmte Probleme durch akribischere Planung oder besseres Management eben doch hätten verhindert werden können. Je größer ein Projekt, desto umfangreicher sind all jene Aspekte, die nicht unmittelbar mit dem wissenschaftlichen Teil der Arbeit zu tun haben. Da sind dann auch handfeste Fähigkeiten im Projektmanagement gefragt. »Viele Kolleg:innen sehen sich allerdings nicht in einer Managementposition und haben ein geringeres Bewusstsein für diese Aufgaben«, sagt Erika Hamden. »Das ist auch verständlich, denn sie sind ja nicht fürs Management in die Forschung gegangen.« Diese Aspekte würden in der Fehleranalyse selten berücksichtigt, seien jedoch enorm wichtig, sagt Hamden.
Bevor das Seil riss
Misserfolge sind für den Fortschritt also unabdingbar, Fehler und Zweifel Zeichen einer Entwicklung. Sich nach einem Rückschlag selbst in Frage zu stellen, statt die Verantwortung woanders zu suchen, ist allerdings schwierig. Eine Fehlerkultur, ein angemessener, kritischer Umgang mit dem Scheitern, müsse erlernt sein, meint Küstenforscher Burkard Baschek. Mit seinem Experiment wollte er die Dynamik kleiner und kurzlebiger mariner Küstenwirbel untersuchen. Diese seien für den Energie- und Nährstofftransport im Ozean elementar, doch bislang kaum erforscht, so der Experte. Also entwickelte er eine mit Sensoren gespickte Schleppkette, um Parameter wie Temperatur, Salzgehalt und Druck in unterschiedlichen Tiefen zu messen. Als das Seil riss – und er einen Großteil seines Budgets für dieses Forschungsprojekt verlor – hätte er seine wissenschaftliche Methode von Grund auf hinterfragen und verwerfen können: Vielleicht hatten die Kolleg:innen doch recht und die Konstruktion hält einer Geschwindigkeit von 10 Knoten im Wasser grundsätzlich nicht stand? »Doch unsere Tests vorab hatten gezeigt, dass wir beim Experiment noch weit von der Belastungsgrenze des Materials entfernt waren. Und 20 Minuten lang funktionierte alles tadellos«, sagt Baschek. Der Fehler muss woanders gelegen haben. Vermutlich traf die Kette unter Wasser ein Hindernis, etwa ein Fischernetz oder einen Container. Diese Kollision, nicht das hohe Tempo des Bootes, führte zum Reißen der Kette, vermutet der Küstenforscher.
Lernprozesse
Baschek und sein Team hinterfragten ihr Scheitern – und entwickelten ihren Ansatz weiter. Sie installierten am oberen Ende der Schleppkette eine Sollbruchstelle und eine Boje. So lässt sich eine gerissene Kette immer wieder bergen. Dreimal kam das Notfallsystem bereits zum Einsatz – und rettete neben Tausenden Dollar Forschungsgeldern auch wichtige Messwerte.
Und das Ballonteleskop von Erika Hamden? Das sei derzeit für Reparaturarbeiten quer über den Globus verteilt, sagt die Astrophysikerin. Sie hofft auf einen erneuten Start im kommenden Jahr. Am Ende unseres Interviews nimmt sie auch die Medien in die Pflicht. Es sei gut und wichtig, dass Journalist:innen über wissenschaftliche Erfolge berichten. »Aber vielleicht fragen Sie und die Kolleg:innen in Zukunft mal gezielter, wie oft etwas nicht funktioniert hat. Oder wie lange etwas von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung dauerte. Das würde das verzerrte Bild von Erfolg und Misserfolg etwas geraderücken.«
Die Rolle der Medien
Hamden hat recht. Die Medien tragen eine Mitverantwortung. Eine ziemlich große. Schließlich verlassen sie für die Wissenschaft häufig ihren gewohnten Pfad der Negativberichterstattung und feiern stattdessen primär die Triumphe, anstatt kritisch nachzufragen oder fehlerhafte Forschungsansätze zu beleuchten. Journalist:innen verkürzen und vereinfachen Forschungsergebnisse für schlagkräftigere Überschriften, für knackigere Zitate, um den Leser:innen nicht zu viel zuzumuten – oder schlicht, weil sie nicht genau gelesen oder nicht richtig zugehört haben.
Auch Fachpublikationen sind davon nicht ausgenommen. »In den seltenen Fällen, in denen eine Zeitschrift eine Studie öffentlich zurückzog, geschah dies meist in einer kryptischen Fußnote. Kaum jemand bekam das mit und viele zurückgezogene Studien wurden noch Jahre später von anderen zitiert«, schreibt der Journalist Benedict Carey in einem Beitrag für die New York Times.
Der Diskurs ums Scheitern, er muss offener geführt werden, ehrlicher – aber auch empathischer und wertfreier. Und zwar von allen Beteiligten. Die Wissenschaft muss das Scheitern umarmen lernen, sie muss betonen und erzählen, was jedem Scheitern innewohnt: eine neue Chance.
Text: Florian Sturm, 22. Juli 2021
Inhalt
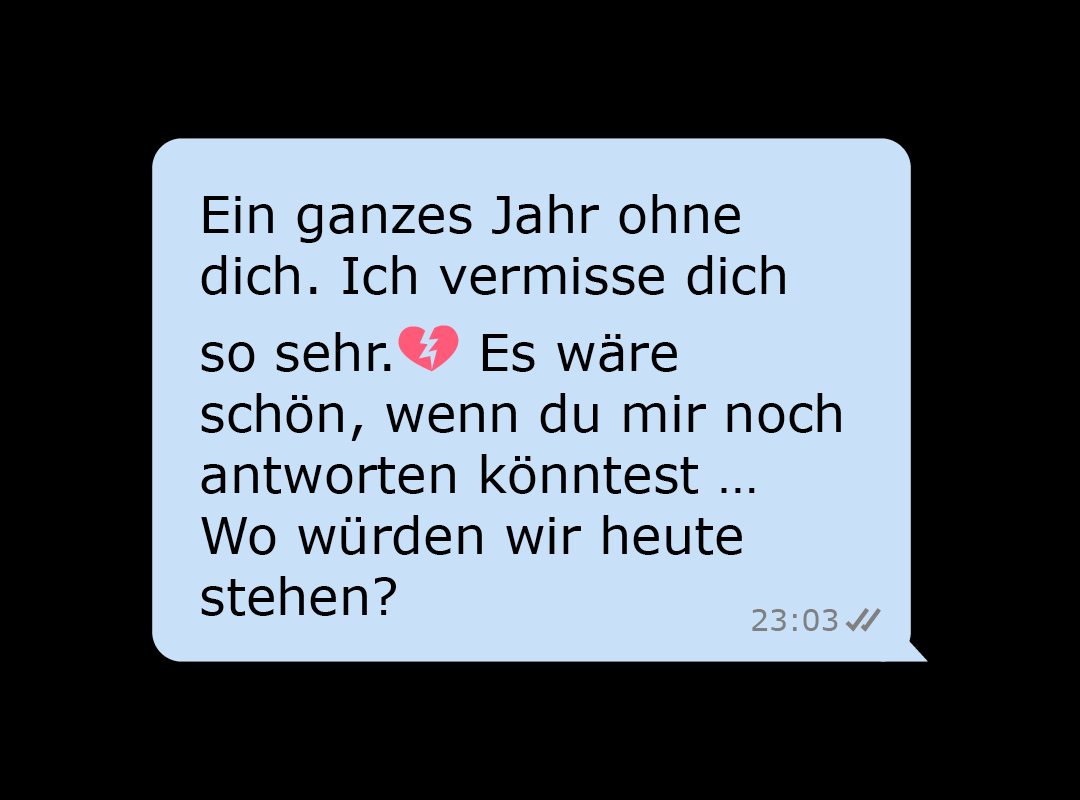
Unsterblich
In Zukunft werden uns immer mehr Tote begleiten: Als digitale Kopien, die nach dem Tod eines Menschen weiterreden, chatten, vielleicht sogar arbeiten. Aber wollen wir sie überhaupt haben in unserer Welt der Lebenden?

Vergiss es, Bruder.
Vergessen ist kein Unfall. Vergessen ist essenziell für unser Hirn, unser Leben, unsere Gesellschaft – ein aktiver Prozess. Ohne Vergessen wäre Erinnern ein Nichts.

Das dunkelste Kapitel der Physik
Viele Jahre lang suchen zwei Wissenschaftlerinnen den Beweis für die Dunkle Materie. Nicht nur die Theorie macht ihnen zu schaffen – auch die Männerwelt der Physik.
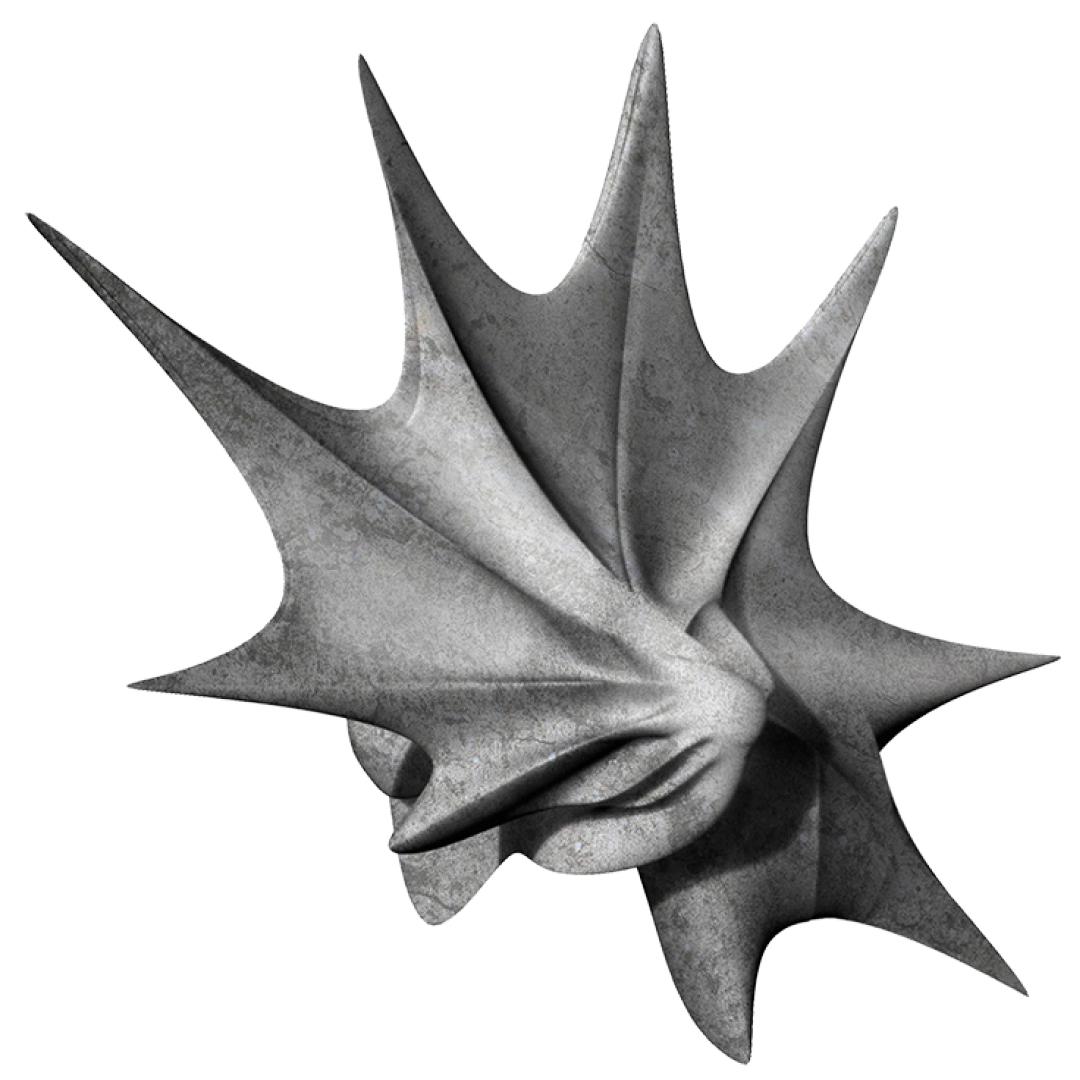
Ein Brocken Nichts
Im Internet ist alles einfach da und irgendwie kommt es zu uns. Dahinter stecken tausende Tonnen Metall und Kunststoff. Drei Studentinnen machen sie greifbar – mit dem BROCKEN.

Sie haben Nichts
Sonja und Petra haben körperliche Beschwerden. Niemand kann erklären, woher sie kommen. Sind sie harmlos oder tödlich? Über den schmalen Grat zwischen Nichts und Etwas in der Medizin.

Wenn das Seil reißt
Über Pannen, gescheiterte Experimente, misslungene Entwicklungen wird nicht gern gesprochen. Doch das Scheitern gehört zu jeder echten Forschung – die Wissenschaft muss lernen, es zu umarmen. Ein Plädoyer.

Nichts bleibt
Barfuß oder Lackschuh,
Alles oder nichts? Die Playlist.
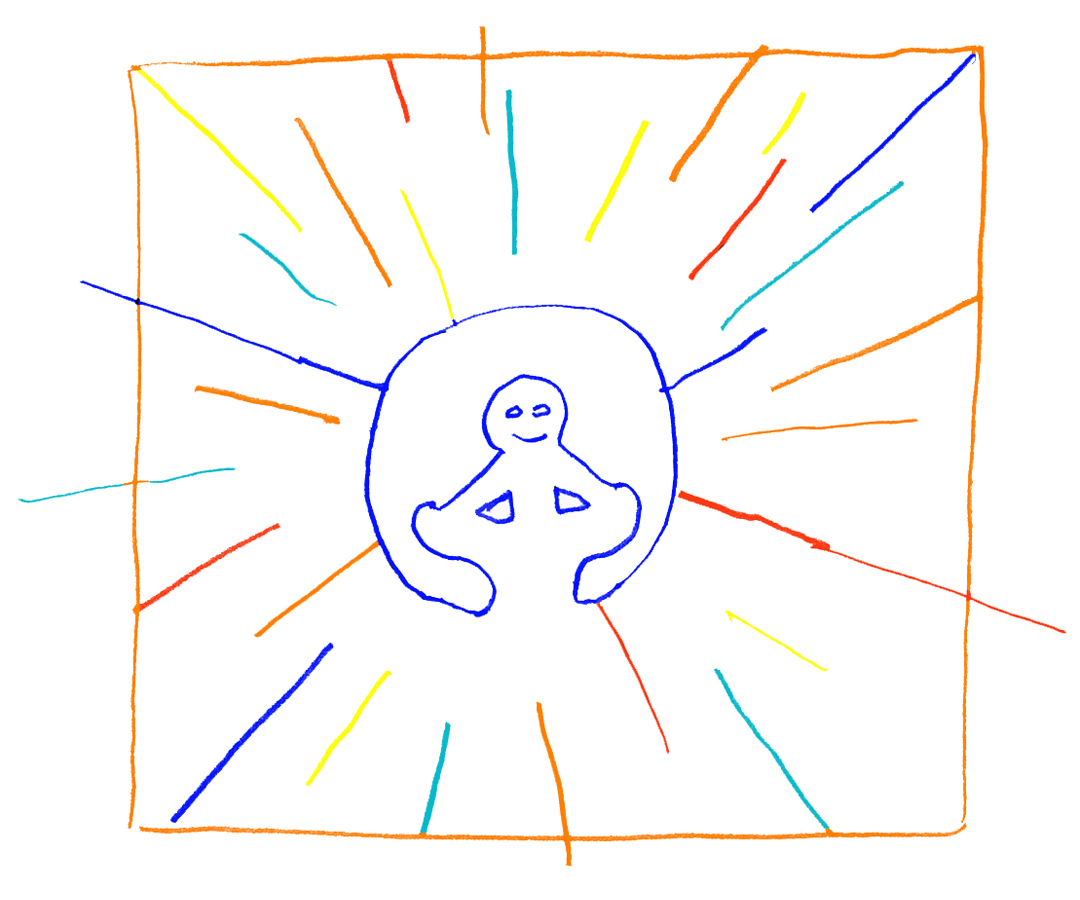
Leere Gedanken
Wer zum ersten Mal meditiert, merkt: Schon bald funken Gedanken dazwischen. Wie erreichen Profis die ersehnte Stille im Kopf? Und was weiß die Neurowissenschaft über diesen Zustand?

Es war Bobobees Idee
Ein Erfinder trifft seine Erfindung wieder – nur kommt sie jetzt aus China. Ein Interview.

Was ich höre
Vier Minuten, dreiunddreißig Sekunden: Nichts. Unsere Autorinnen erzählen von einem Hörerlebnis.